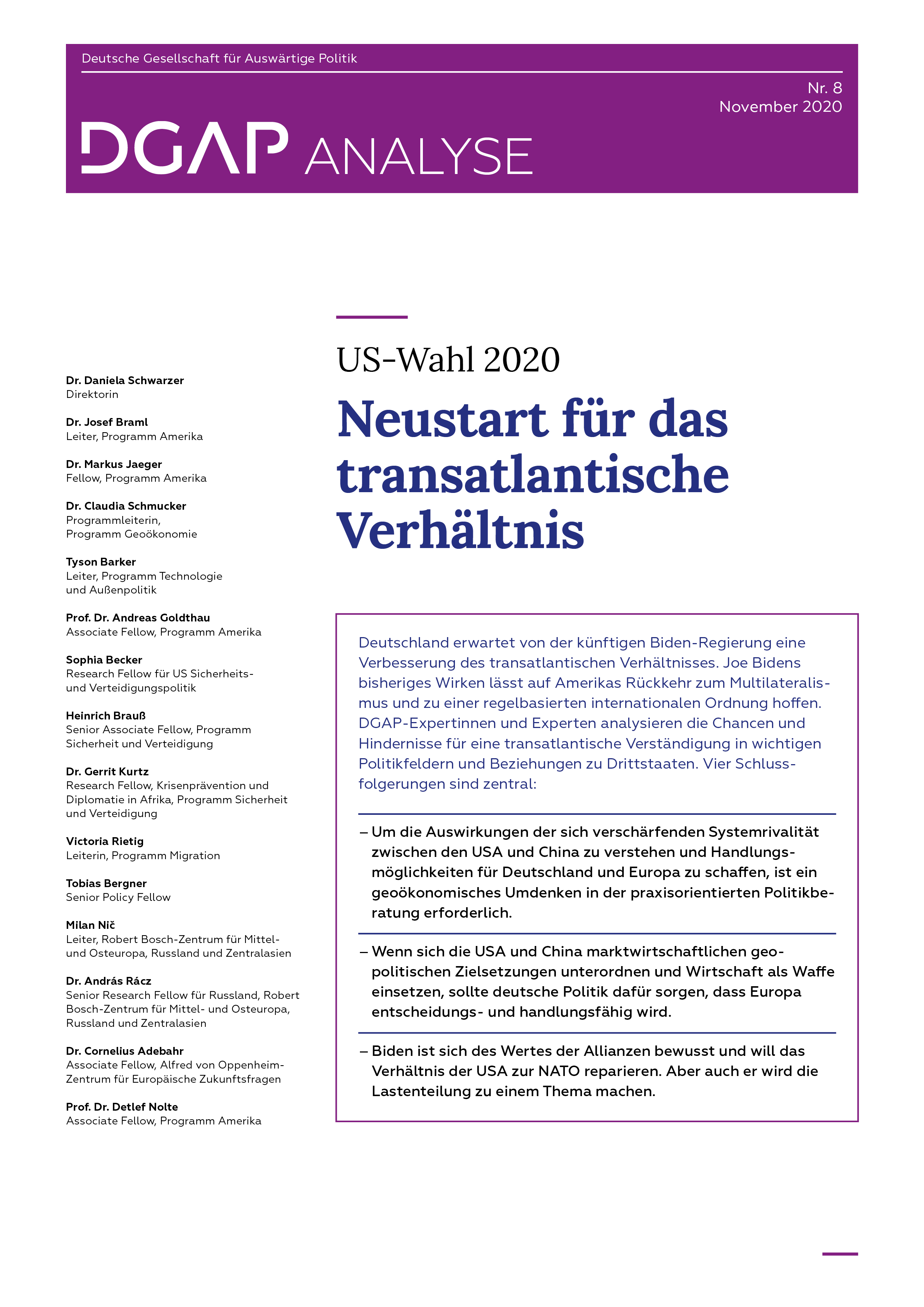Inhalt
Internationale Ordnung | Handelspolitik | Globale Gesundheit | Finanzpolitik | Umwelt- und Energiepolitik | Technologie | Sicherheitspolitik | Rüstungskontrolle | UN-Friedensmissionen | China | Russland | Iran | Lateinamerika | Afrika | Migrationspolitik
Internationale Ordnung
Deutschland muss einen höheren Beitrag leisten
Joe Biden wurde zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt – mit deutlich mehr Stimmen als jemals ein Kandidat vor ihm. Gerade in Europa lässt dieses Ergebnis auf einen transatlantischen Neubeginn hoffen. Ob die Covid-19-Bekämpfung, die wirtschaftliche Erholung, engagierte Klimaziele oder der Aufstieg Chinas – nach vier Jahren politischer Eiszeit mangelt es nicht an Fragen, die einer transatlantisch koordinierten multilateralen Antwort bedürfen. Doch haben die Wahl und die Reaktion des bisherigen Amtsinhabers auf seine Niederlage gezeigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Inneren noch uneiniger und polarisierter geworden sind – selbst im Hinblick auf demokratische Grundwerte und Gepflogenheiten.
Politische Blockade und gesellschaftliche Polarisierung sind nichts Neues im Land der mittlerweile begrenzten Möglichkeiten. Schon vor der Amtszeit von Donald Trump war das politische System der USA nicht mehr in der Lage, gravierende Probleme des Landes zu lösen. Vor allem auch wegen der daraus resultierenden Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit vieler Bürgerinnen und Bürger mit dem politischen Establishment konnte ein Außenseiter wie Trump überhaupt erst ins Weiße Haus gelangen. Der Aufstieg eines Populisten wie Trump und der auf beiden Seiten mit protektionistischen Parolen geführte Wahlkampf sind vielmehr Symptom als Ursache tieferliegender struktureller Probleme. Diese werden auch das künftige Regieren Joe Bidens massiv beeinträchtigen. Denn auch nach den Präsidentschafts- und Kongresswahlen bleibt die politische Lage schwierig. Mit einer „geteilten Regierung“ – in der das Weiße Haus und die beiden Kammern im Kongress, das Abgeordnetenhaus und der Senat, voraussichtlich wieder von unterschiedlichen Parteien regiert werden – ist politischer Stillstand in den meisten Politikfeldern programmiert.
Die innenpolitische und gesellschaftliche Ausgangslage wird weitreichende Konsequenzen für die transatlantischen Beziehungen und für Europa haben. Wegen ihrer durch die Pandemie verschärften wirtschaftlichen Notlage und ihrer enormen Verschuldung werden die USA auch unter der künftigen Regierung Biden von Europa einen deutlich höheren Beitrag zur Lastenteilung erwarten. Bereits während der Regierung unter Barack Obama, in der Biden als Vizepräsident vor allem außenpolitische Dossiers mitverantwortete, warnte der damalige Verteidigungsminister Bob Gates in einer Brandrede, dass die US-Bevölkerung und ihre Repräsentanten die Sicherheitslasten für die Alliierten nicht mehr länger schultern würden. Auf dem Gipfel in Wales 2014 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten folgerichtig, dass sie „darauf abzielen, sich innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen".
Der Druck auf die Europäer wird sich in dem Maße erhöhen, in dem die wirtschaftliche Erholung auf sich warten lässt. Auch wird die Kritik der US-Administration an China und Deutschland wegen ihrer Exportstärke nicht nachlassen. Zwar sind die Finanzmärkte kürzlich mit der Erforschung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus beflügelt worden. Doch sie könnten mit ihrer in den aktuellen Kursen reflektierten Erwartung anhaltender staatlicher Konjunkturprogramme enttäuscht werden. Die Unfähigkeit der US-Politik, einen Konsens über künftige Konjunkturmaßnahmen zu erzielen, könnte die optimistische Marktstimmung schon bald dämpfen. Ohne überparteiliche Einigung zur Verlängerung der Arbeitslosenhilfe verlieren Millionen von US-Haushalten ihre Existenzgrundlage, denn die staatliche Unterstützung hatte sie in den vergangenen fünf Monaten über Wasser gehalten. Die Pandemie hat die bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten offengelegt. Zwar wurde der enorme wirtschaftliche Einbruch (um ein Drittel der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal) im dritten Quartal 2020 wieder korrigiert. Eine von Analysten erhoffte V-förmige Erholung setzt jedoch voraus, dass die großen Volkswirtschaften nicht gezwungen werden, wieder zu schließen. Angesichts der weiterhin alarmierenden Infektionszahlen, sowohl in den USA als auch in Europa, ist eine nachhaltige Erholung aller Wirtschaftsbereiche eher unwahrscheinlich.
Diese innenpolitischen und wirtschaftlichen Faktoren sollten deutsche und europäische Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft berücksichtigen, wenn sie ihre Prioritäten auf der transatlantischen Agenda und in multilateralen Zusammenhängen definieren und Handlungsoptionen bewerten.
Dieses Web-Dossier bietet kurze Analysen und Empfehlungen an mit dem Ziel, frühzeitig transatlantische Konflikte und Chancen erkennen zu helfen, und diese besser managen oder nutzen können: etwa in der Finanz-, Handels-, Technologie-, Energie/Klima- Sicherheits-, Migrations- und Gesundheitspolitik sowie in diversen bilateralen, regionalen und multilateralen Beziehungen, etwa zu China, Russland, Iran, Afrika, Lateinamerika. Und nicht zuletzt geht es auch um gemeinsame transatlantische Anstrengungen, vielleicht doch noch eine multilaterale, regelbasierte Weltordnung zu erhalten und weiterzuentwickeln, von der Deutschlands Wirtschaft und das gesellschaftliches Leben elementar abhängen.
Geoökonomie
Das wichtigste Feld für die transatlantische Handelspolitik ist die Reform der WTO
Die Wahl von Präsident Joe Biden ermöglicht einen Neustart in den transatlantischen Handelsbeziehungen. Biden ist überzeugter Transatlantiker und weiß den Wert von Verbündeten wie der EU zu schätzen. Deshalb wird er versuchen, Dialog, Vertrauen und Sicherheit in den transatlantischen Handelsbeziehungen wiederherzustellen.
Probleme
Die transatlantische Handelspartnerschaft wird jedoch nicht einfach zu früheren Zeiten zurückkehren. Bidens Fokus wird zunächst nicht auf der Handelspolitik liegen, sondern auf der wirtschaftlichen Erholung der USA nach der Corona-Krise. Seine ersten Themen werden daher neben der Bekämpfung der Krise auf der wirtschaftlichen Erholung der USA liegen. In dieser Hinsicht werden die Maßnahmen zur Förderung des Reshoring (Produktionsrückverlagerung) fortgesetzt. Die Exportkontrollen werden ebenso streng bleiben wie das Investitions-Screening. Auch die „Buy American“ Vorschriften werden verschärft – zulasten von europäischen Unternehmen.
Selbst wenn Biden den Zollkonflikt mit der EU beendet, ist kein ehrgeiziges neues Handelsabkommen wie TTIP mit der EU in Sicht. Trumps Vorwurf, dass die USA auf den Weltmärkten ungerecht behandelt worden sind, findet auch bei Biden-Wählern viele Unterstützung. Daher wird es auch für die neue Regierung wichtig sein, den Zugang zum europäischen Binnenmarkt (inklusive Agrarmarkt) zu verbessern. Und obwohl Biden seine Unterstützung für den Klimaschutz unterstrichen hat, wird er der europäischen Idee der Carbon Border Adjustment Measures im Handel weiterhin kritisch gegenüberstehen. Auch die angedachte europäische Besteuerung von digitalen Unternehmen wird unter einer Präsidentschaft Bidens zu Problemen im transatlantischen Verhältnis führen.
Der geoökonomische Handels- und Technologiekonflikt mit China wird fortgesetzt, da dieses Thema parteiübergreifende Unterstützung findet. Hier wird die EU daher deutlich mehr Partei ergreifen müssen als bisher.
Chancen
Trotz dieser bestehenden Schwierigkeiten im transatlantischen Handel wird sich der Ton und die Dialogbereitschaft grundsätzlich verbessern. Das vielversprechendste Feld für die zukünftige Zusammenarbeit wird eine erneute transatlantische Kooperation in multilateralen Foren sein. Biden glaubt an die Bedeutung von internationalem Recht und internationalen Organisationen. Er wird sich daher bemühen, zumindest teilweise die Führungsrolle der USA auf der Weltbühne wiederherzustellen. Als solcher wird er sich für die Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen und zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) einsetzen - zwei wichtige Bereiche für die Zusammenarbeit mit der EU.
Die neue Kooperationsbereitschaft bezieht sich aber auch auf die Welthandelsorganisation (WTO). Hier gibt es die Möglichkeit der Zusammenarbeit bei der Modernisierung der Regeln (z.B. strengere Regeln bei Industriesubventionen) und neuen plurilateralen Initiativen (zum Beispiel zum digitalen Handel und zu Umweltgütern/EGA). In Bezug auf den Appellate Body der WTO wird die Kritik von beiden Parteien im US-Kongress geteilt. Daher ist eine Reform unumgänglich. Aber - anders als die derzeitige Regierung - wird die Biden-Präsidentschaft offen sein für einen Reformdialog mit der EU.
Empfehlungen
Die Verbesserung der transatlantischen Beziehungen ist unter einem Präsident Biden möglich. Aber auch wenn dabei ein transatlantischer Handelskrieg vermieden werden kann, muss sich die EU darauf einstellen, dass Biden konsequent die wirtschaftlichen Interessen der USA verfolgt. Daher ist weiterhin mit Maßnahmen wie Reshoring und „Buy American“ Vorschriften zu rechnen. Die EU wird zusätzlich viel stärker gefordert sein, sich im Konflikt mit China zu engagieren und Partei zu ergreifen.
Die EU muss die bestehenden Anknüpfungspunkte im multilateralen Bereich nutzen, um zusammen mit den USA die globalen Probleme (gemeinsame Entwicklung eines Impfstoffes, Umweltschutz, Reform der WTO) anzugehen. Dabei muss sie jedoch bereit sein, sich stärker auf der Weltbühne zu engagieren und auch die Risiken mitzutragen.
Initiative für eine transatlantische Partnerschaft zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur
In der Gesundheitspolitik wird der Mehrwert internationaler Zusammenarbeit so deutlich wie in kaum einem anderen Bereich: Nur gemeinsam lassen sich die globalen Herausforderungen von Gesundheitskrisen bewältigen. Der wichtigste internationale Akteur in der COVID-19-Pandemie ist die Weltgesundheitsorganisation WHO, deren wichtigstes Geberland die USA sind.
US-Präsident Donald Trump kündigte die Mitgliedschaft seines Landes in der WHO; Joe Biden hatte im Wahlkampf erklärt, sie wieder herstellen zu wollen. Tatsächlich liegt der Verbleib der USA in der WHO im Interesse aller Länder, auch der Vereinigten Staaten selbst. Nur als Mitglied können sie die globale Gesundheitsarchitektur und Verbesserungen der WHO mitgestalten.
Das internationale System der Gesundheitszusammenarbeit lebt von umfassender Teilnahme: Auf der Landkarte der Mitgliedstaaten sollte es keine weißen Flecken geben. Ein umfassender Schutz der Menschen vor Krankheiten und Pandemien ist nur dann gewährleistet, wenn er überall sichergestellt ist. Die Aussage, dass Krankheiten keine Grenzen kennen, ist mittlerweile eine Binsenweisheit.
Die USA sind bislang der bei weitem größte Geber im globalen Gesundheitssektor. Das gilt insbesondere für die WHO, die rund 15 Prozent ihrer Mittel von den USA erhält. Darüber hinaus arbeiten zahlreiche US-Experten in der WHO, deren Kenntnisse und Wissen nicht zu ersetzen sind. Der Beitrag der USA zur WHO – inhaltlich wie finanziell – kann von einzelnen anderen Mitgliedsstaaten oder Gebern nicht ausgeglichen werden.
US-Präsident Donald Trump jedoch warf der WHO vor, unter chinesischem Einfluss zu stehen und zu spät über den COVID-19-Ausbruch informiert zu haben. Im Sommer 2020 kündigte er den Rückzug der USA aus der WHO an. Wenn er nicht widerrufen wird, wird dieser Austritt am 6. Juli 2021 wirksam, ein Jahr nach Übermittlung des Kündigungsschreibens, das der Ständige Vertreter der USA in Genf der WHO übergab.
Vor dem Hintergrund von Trumps Kündigung ergriffen Deutschland und Frankreich die Initiative und präsentierten bereits im September Anregungen für eine Stärkung der WHO. Es geht dabei um Verbesserungen, die bereits in der Phase der Pandemiebekämpfung in Angriff genommen werden sollen wie z.B. einen verbesserten Informationsaustausch über Ausbruchsgeschehen.
Es ist absehbar, dass die Aufmerksamkeit der neuen US-Administration in der Anfangszeit auf nationalen Herausforderungen und der Bewältigung der COVID-19-Pandemie im eigenen Land liegen wird. Und umso mehr kommt den Europäern eine Führungsrolle zu, um den Prozess der Verbesserung der globalen Gesundheitsarchitektur zügig voranzubringen. In die Diskussionen über die Reform der WHO sollte die neue US-Administration unbedingt frühzeitig eingebunden werden.
Die Partner der USA sollten das Ende des Wahlkampfs und den Ausgang der Wahlen in den USA dazu nutzen, für gemeinsame Aktivitäten zu werben. Es gilt, jetzt keine Zeit zu verlieren und gemeinsam an die Aufgabe zu gehen, die globale Gesundheitsarchitektur zu verbessern.
Die europäischen Partner sollten schon jetzt, während der diese Woche (9.-14.11.2020) stattfindenden World Health Assembly, der Versammlung der Mitgliedstaaten der WHO, aktiv für ein US-Engagement in der WHO werben.
Europa würde so unterstreichen, dass es die aktive Beteiligung der USA im multilateralen System will und sucht. Zugleich wäre dies ein wichtiges Zeichen für die transatlantische Partnerschaft. Die WHO als Mitgliederorganisation kann nur so gut sein, wie ihre Mitglieder es wünschen und sie entsprechend unterstützen; dazu müssen alle beitragen und dazu müssen wir die USA wiedergewinnen. Europa handelt im eigenen und im Interesse der Weltgemeinschaft, wenn es die USA für eine transatlantische Partnerschaft zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur gewinnt.
Biden-Präsidentschaft und republikanischer Senat: finanzpolitischer Stillstand
Sollten die Demokraten – und danach sieht es momentan aus – es nicht schaffen, die Mehrheit im Senat zu erringen, dann wird die ambitiöse Finanzpolitik Joe Bidens der republikanischen Opposition zum Opfer fallen. Ein dringend notwendiges Hilfspaket zur Pandemiebekämpfung und zur kurzfristigen Stabilisierung der Wirtschaft wird kleiner ausfallen, wenn es darüber überhaupt zu einer Einigung kommt.
Ein republikanisch beherrschter Senat wird nur äußerst eingeschränkt, finanzpolitische Kompromissbereitschaft demonstrieren, v.a. was das von Biden vorgeschlagene, großangelegte Investitionsprogramm angeht. Die schon unter der Präsidentschaft von Barack Obama ausgeübte Fundamentalopposition der republikanischen Partei wird sich in einem aufgrund des knappen Wahlausgangs politisch aufgeheizten und hochpolarisierten Klima nur verstärken.
Deswegen wird das Investitionsprogramm von Biden mit Fokus auf Infrastruktur und Umwelttechnologie nicht einmal in Ansätzen durch den Kongress zu bringen sein. Damit verpassen die USA eine große Chance, die amerikanische Wirtschaft fiskalisch anzukurbeln und durch produktivitätssteigernde Investitionen die längerfristigen Wachstumsaussichten zu verbessern.
Dabei wären die USA sowohl budgetpolitisch als auch finanziell in der Lage, eine expansive Fiskalpolitik zu betreiben. Zum einen läuft der Budget Control Act (2011), der in den vergangenen zehn Jahren nicht nur den Anstieg der Staatsausgaben begrenzte, sondern auch die nicht-militärischen Ermessenausgaben an den Anstieg der verteidigungspolitischen Ermessenausgaben koppelte, aus. Dies hätte einem demokratischen Kongress budgetpolitisch großen Spielraum eröffnet. Darüber hinaus unterstützt, öffentlichen Meinungsumfragen zufolge, eine klare Mehrheit der Bevölkerung Bidens Ausgabenpolitik. Außerdem haben die USA dank niedriger Zinsen und quantitativer Lockerungspolitik der Federal Reserve kurz- und mittelfristig mehr als genügend finanzpolitischen Spielraum, obwohl das Defizit dieses Jahr mit über 15 Prozent des BIP den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreichen wird.
Eine wenig wachstumsfreundliche Fiskalpolitik wird die wirtschaftliche Erholung der USA kurz- und mittelfristig verlangsamen. Sobald die Pandemie abflaut bzw. unter Kontrolle gebracht ist, wird es natürlich zu einer wirtschaftlichen Erholung kommen. Aber eine durch höhere Ausgaben getriebene Finanzpolitik würde die Erholung beschleunigen, wovon vor allem Deutschland profitieren würde. Denn der Wert deutscher Warenexporte in die USA beläuft sich auf annähernd 3,5 Prozent des BIP (oder 8 Prozent der Gesamtexporte). Damit bleiben die USA vor Frankreich und China Deutschlands bedeutendster Handelspartner.
Mit einem republikanischen Senat wird es unmöglich sein, größere Kürzungen im US-Verteidigungsetat durchzuführen. Einige demokratische Abgeordnete hatten dies im Hinblick auf das Auslaufen des Budget Control Act‘s vorgeschlagen. Dies hätte negative Folgen für die amerikanische Militärpräsenz in Europa. Damit hätten sich unweigerlich auch die bestehenden amerikanischen Forderungen nach höheren europäischen und v.a. deutschen Verteidigungsausgaben verstärkt.
Die Aussicht auf eine internationale finanzpolitische Koordinierung existiert so gut wie nicht. Ein Präsident Biden wird sich auf innenpolitische und binnenwirtschaftliche Probleme konzentrieren. Sollte er den Republikanern dennoch finanzpolitischen Spielraum abringen können, dann wird er diesen zur Lösung der eigenen wirtschaftlichen Probleme einsetzen. Sollte es Biden beispielsweise gelingen, Teile seines Buy America-Programmes umzusetzen, dann würde dies sogar zu Reibungen mit den Europäern führen – auch wenn Biden versprochen hat, das bestehende multilaterale Regelwerk für das öffentliche Auftragswesen in Konsultation mit Amerikas Partnern zu reformieren und sich nicht unilateral über die bestehenden internationalen Regeln hinwegzusetzen.
Transatlantischer Green Deal: Nullsummendenken überwinden, gemeinsame Interessen wahren
Klimapolitiker dies- und jenseits des Atlantiks feiern Joe Bidens Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen und die damit verbundene Aussicht auf einen „Neuen Transatlantischen Green Deal“. Doch die Biden-Administration wird auch weiter mit ihrem energiepolitischen Pfund wuchern.
Denn auch wenn die Biden-Administration einen multilateralen Weg in der Klimapolitik einschlagen wird, wird sie das umstrittene heimische Fracking von Öl und Gas nicht verbieten. Grüne Industriepolitik gilt als Jobmotor, Erdgas aber weiterhin auch als der im Vergleich „sauberere“ Energieträger in der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Ölproduktion auf öffentlichem Land wird nicht weiter forciert, die Industrie selbst jedoch nicht infrage gestellt. Damit bleiben einige der zentralen von der Trump-Regierung forcierten Konflikte um fossile Energieträger weiter virulent.
Jüngst teilte der Energiekonzern Uniper mit, dass in Wilhelmshaven vorerst kein Terminal für den Import von amerikanischem Flüssiggas (LNG) gebaut wird. Mit dieser Entscheidung entfällt auch ein Kompromissangebot der Bundesregierung, die mit dem Verweis auf geplante Flüssiggas-Terminals den Streit mit den USA über die umstrittene Nord-Stream-2-Pipeline zu entschärfen suchte. Berlin wollte damit der Argumentation Washingtons entgegenkommen, gemäß der amerikanisches „Freedom Gas“ Europas Abhängigkeit von russischen Gas-Lieferungen vermindern sollte.
Dahinter steht ein strukturelles Problem: Angesichts der Corona-Pandemie ist das hoch bepreiste US-Flüssiggas LNG für Europas Unternehmen wirtschaftlich nicht attraktiv. Zudem macht der Nachfrageeinbruch bei Erdgas Neuinvestitionen in zusätzliche Import-Infrastruktur unattraktiv.
Ein transatlantischer Testfall ist also absehbar, der ein wichtiges Signal dafür geben wird, ob unter einer Biden-Regierung amerikanische und deutsche Entscheidungsträger wie bisher nach unterschiedlichen Logiken handeln oder der transatlantische Konflikt künftig einvernehmlich gelöst werden kann.
Denn auch wenn die „Energiedominanz“ nicht mehr die offizielle Doktrin ist, so wird geoökonomisches Denken auch in der neuen Biden-Regierung weitere Wirkmacht entfalten und von gleichgesinnten Repräsentanten und Senatoren im Kongress flankiert. So wird Saudi-Arabien auch von der künftigen US-Regierung daran erinnert, dass die Sicherheit der Ölmonarchie vom militärischen Schutz der USA abhängt und zur Mäßigung seiner Produktion angehalten, damit nicht ein weiterer Ölpreisverfall die amerikanische Energieproduktion in den Ruin treibt. Ebenso werden die europäischen Alliierten weiterhin aufgefordert, Tribut für die Pax Americana zu zollen, indem sie anstelle des billigeren russischen Gases mehr „Freiheitsgas“ aus den USA beziehen. Gleichzeitig werden die Sanktionsdrohungen der USA gegen die europäischen Projektpartner der Pipeline Nord Stream 2, etwa die BASF-Tochter Wintershall, Uniper und die Hafengesellschaft Sassnitz/Mukran aufrechterhalten. Und wer in Europa wieder mit Geschäften im Iran rechnet, unterschätzt dass auch unter der neuen Biden-Regierung die USA den Iran durch (Sekundär-) Sanktionen von der Förderung seiner üppig vorhandenen Ressourcen abhalten werden.
Unter einer Biden-Regierung wird sich der Stil ändern, nicht die geoökonomische Ausrichtung amerikanischer Energie-Außenpolitik. Deutsche Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft brauchen daher strategische Geduld und müssen Bereiche identifizieren, in denen sie mit den USA energie- und klimapolitisch zusammenarbeiten können.
Eine der Möglichkeiten ist es, gemeinsam Wege zu beschreiten, um die Abhängigkeit westlicher Volkswirtschaften von fossilen Brennstoffen durch eine transatlantische Energie- und Umwelt-Kooperation zu verringern. (Ausführlicher dazu: DGAP Analyse Nr. 7/2020: Josef Braml, Neue Energie in den transatlantischen Beziehungen). Zudem werden die USA ihre Handels- und Klimapolitik strategisch verbinden, um die heimische grüne Energieindustrie zu fördern. Europa tut dies im Rahmen seines European Green Deal und der geplanten CO2- Grenzsteuer. Hier besteht großes Potential zur strategischen transatlantischen Kooperation. Handelspolitisch Sinn machen wird es allemal, angesichts der Größe der beiden Wirtschaftsblöcke.
Selbst wenn viele energie- und umweltpolitische Initiativen von einer voraussichtlich weiterhin republikanischen Mehrheit im Senat bis auf weiteres vereitelt werden, gibt Bidens „Plan für eine saubere Energierevolution und Umweltgerechtigkeit“ langfristig Grund zur Hoffnung, dass ein „Transatlantischer Green Deal“ der Weg nach vorne sein kann.
Chance auf Partnerschaft im Datenschutz und bei Zukunftstechnologien
Die Tech-Governance-Philosophie des gewählten Präsidenten Joe Biden fasst die Information Technology and Innovation Foundation in sechs Worten zusammen: „mehr Ausgaben, mehr Regulierung, mehr Multilateralismus“. Alle drei Aspekte könnten sich positiv auf die transatlantische Zusammenarbeit im Technologiesektor auswirken. Die neue Biden-Regierung wird bemüht sein, Zukunftstechnologien durch staatliche Beihilfen, Forschungs- und Entwicklungsinitiativen und eine Ausweitung der diplomatischen Beziehungen zu fördern und auf diese Weise die Partnerschaft der US-Regierung mit technologischen Schlüssel-Industrien und gleichgesinnten Akteuren in Europa und Asien zu vertiefen.
Problempotential
Die neue Biden-Regierung wird den Erhalt der technologischen Vorherrschaft als einen der Schwerpunkte ihrer nationalen sicherheitspolitischen Strategie definieren und bei Maßnahmen im Bereich der Zukunftstechnologien die Rivalität zwischen den beiden Supermächten USA und China im Blick haben. Im Gegensatz dazu bemüht sich Europa mit geeinten Kräften um „digitale Souveränität“ und technologische Unabhängigkeit, sowohl von den USA als auch von China. Soweit derartige Bestrebungen dazu beitragen, das demokratische Netz zu spalten und protektionistische Tendenzen im Technologiebereich zu befördern, könnten sie als transatlantisches Reizthema an Gewicht gewinnen.
Chancen
In der Technologiepolitik besteht zwischen Europa und den USA ein weitreichender Konsens. Mit Blick auf China führte die Covid-Krise dazu, dass sich die negative Haltung Europas gegenüber einer Abhängigkeit von chinesischen Technologien, insbesondere in Bezug auf Telekommunikationsgeräte, aber auch Cloud-Dienste, soziale Medien und KI-Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, weiter verhärtet. Die Biden-Regierung wird sich in ihren Beziehungen zu China auch weiterhin gegen Merkantilismus, Cyber-Diebstahl oder den Einsatz von Gesichtserkennung und KI zur Unterdrückung der Bevölkerung einsetzen. Sie wird dafür allerdings auf Partner angewiesen sein, um einen solchen Widerstand durch partnerschaftliches Vorgehen wirksamer zu gestalten.
Auch in anderen Bereichen herrscht Konsens. Insbesondere Kalifornien und zunehmend auch Washington streben strengere Datenschutzregelungen an, die sich an der EU-Datenschutzverordnung DSGVO orientieren. Im Bereich der Plattformregulierung hat sich beiderseits des Atlantik die Haltung gegenüber Big-Tech-Plattformen als verlässlichen Hütern der Demokratie deutlich verschlechtert. Mit Blick auf Desinformation und Hassreden will Biden den Haftungsschutz nach Abschnitt 230 des Communications Decency Act (CDA) einschränken und so den Kreislauf der Radikalisierung durch Algorithmen durchbrechen.
Empfehlungen
Die Biden-Regierung wird darum bemüht sein, die Vorteile eines kooperativen Multilateralismus unter Beweis zu stellen. Hier fällt Deutschland eine entscheidende Rolle zu. Deutschland und Europa können sich an den folgenden vier Handlungsrichtlinien orientieren:
1. Der Biden-Regierung Zeit lassen, um sich neu zu orientieren und Anschluss zu finden: Die EU arbeitet mit Hochdruck an einer Neufassung ihrer Technologievorschriften. Dabei geht es um das Überdenken von Desinformation, Hassreden und Haftungsbeschränkungen für Plattformen; um eine Neubewertung der Plattformen von Big-Tech-Unternehmen als Gatekeeper; um die Ausarbeitung neuer KI-, Cyber- und Branchenregeln; um die Einführung eines föderierten Cloud-Ökosystems im Rahmen der europäischen Cloud Gaia-X sowie in einigen Ländern um die Einführung einer Steuer auf digitale Dienstleistungen. In vielen Bereichen teilt die Biden-Regierung diese Zielsetzungen und strebt eine konstruktive Partnerschaft an. Washington benötigt Zeit – und die geeigneten Mechanismen –, um sich gemeinsam mit Europa auf konstruktive Weise um die Umsetzung dieses umfangreichen Pakets mit Entwürfen für neue Rechtsvorschriften zu bemühen. Diesem Zweck könnte beispielsweise der Beschluss der OECD dienen, die Einführung einer Steuer auf digitale Dienstleistungen auf Mitte 2021 zu verschieben.
2. Einen EU-US Technology Council einsetzen: Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen hat die Aufnahme eines ressortübergreifenden strategischen Dialogs zur Technologiepolitik gefordert; eine Initiative, die von der Trump-Regierung allerdings nie aufgegriffen wurde. Zu Beginn der Präsidentschaft muss die EU erneut einen Vorstoß in dieser Angelegenheit unternehmen und sich für einen interinstitutionellen Prozess im Weißen Haus, möglicherweise mit Vizepräsidentin Kamala Harris als stellvertretender Vorsitzenden, einsetzen.
3. Im Rahmen des Demokratiegipfels den Fokus auf digitale Rechte legen: Für den Beginn seiner Amtszeit hat Biden die Einberufung eines großen Gipfeltreffens demokratischer Staaten angekündigt. Deutschland und gleichgesinnte europäische Staaten müssen diesen Gipfel als Plattform nutzen, um die Ausarbeitung einer Charta der digitalen Rechte zu personenbezogenen Daten, algorithmischen Entscheidungsprozessen, menschzentrierter KI und Zukunftstechnologien wie Gesichtserkennung voranzutreiben. Darüber hinaus müssen sie gemeinsam durchführbare Maßnahmen gegen Staaten festlegen, die Technologien dafür nutzen, ihre Bevölkerung zu unterdrücken oder im Ausland Zwietracht zu säen.
4. Gemeinsame Bemühungen der EU, der USA und Großbritanniens um eine Wiederbelebung des transatlantischen Datenverkehrs: Kurzfristige Schwierigkeiten im freien Datenverkehr führen zu Unsicherheit in den technologischen Beziehungen zwischen der EU und den USA bzw. Großbritannien. Alle drei Seiten müssen sich gemeinsam um die Schaffung eines zuverlässigen Datenraums bemühen, der den Zugang zu Geheimdienstinformationen, die Öffnung des transatlantischen Datenverkehrs und den Schutz der Grundrechte gewährleistet.
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Sicherheitspolitik: USA werden sich zur NATO bekennen
Der Sieg von Joe Biden ist wichtig für das transatlantische Bündnis. Die NATO ist eine Organisation, die auf der Verpflichtung zur gegenseitigen Verteidigung aufgebaut ist, und sie erfordert daher Vertrauen in die Bereitschaft aller Mitglieder, diese Verpflichtungen einzuhalten. In den vergangenen vier Jahren ist viel Vertrauen verloren gegangen. Präsident Donald Trump hat immer wieder den Wert der NATO in Frage gestellt und sogar damit gedroht, das Bündnis zu verlassen. Mit dem Amtsantritt von Biden im Januar 2021 kann Europa erwarten, dass sich die Vereinigten Staaten wieder zu ihren Bündnissen und zur NATO bekennen.
US-Wahlsieger Biden ist sich des Wertes der amerikanischen Allianzen bewusst und entschlossen, diese Beziehungen zu reparieren. Die Europäer können daher erwarten, dass er den Kontinent frühzeitig besuchen und die amerikanischen Verpflichtungen gegenüber der NATO bestätigen wird. Angesichts der wachsenden Bedrohungen in Europas Nachbarschaft ist die transatlantische Zusammenarbeit von größter Bedeutung. Biden weiß, dass er auf Europa angewiesen ist und umgekehrt, dass Europa die USA dringend braucht. Er möchte mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um ein neues strategisches Konzept der NATO auszuarbeiten, das den aktuellen Herausforderungen Rechnung trägt.
Biden versicherte außerdem den osteuropäischen Verbündeten, dass sich seine Regierung weiterhin für die Finanzierung der Europäischen Abschreckungsinitiative (EDI) einsetzen werde, um Russland an der Ostflanke der NATO unter Kontrolle zu haben. Als Präsident wird er höchstwahrscheinlich den von seinem Vorgänger Trump im Sommer angekündigten Abzug von 12.000 Soldaten aus Deutschland revidieren. Diese Versicherung der Vereinigten Staaten berührt die raison d’être der NATO.
Die Lastenteilung in der NATO wird jedoch auch unter einer Biden-Präsidentschaft ein Thema sein. Trump hatte bei mehreren Gelegenheiten erklärt, dass die USA bereit wären, die NATO zu verlassen, wenn die europäischen Verbündeten ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhen würden. Vor allem Deutschland hat die Kritik des Präsidenten auf sich gezogen. Selbst unter einer Biden-Administration ist zu erwarten, dass die Vereinigten Staaten ihre Verbündeten – wenn auch in freundlicheren Worten – daran erinnern werden, sich an die auf dem Gipfel in Wales 2014 vereinbarten Verpflichtungen zu halten.
Die Debatte über die Finanzen wird sich vermutlich sogar noch verschärfen, da die öffentlichen Haushalte infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zunehmend unter Druck geraten. Die Verteidigungshaushalte werden von finanziellen Umschichtungen sicher nicht verschont bleiben – auch nicht in den USA. Michèle Flournoy, die als Bidens zukünftige Verteidigungsministerin gehandelt wird, räumte bereits ein, dass Prioritäten gesetzt werden müssten. So werden die USA wahrscheinlich weniger Ressourcen zur Verfügung haben und sich darauf verlassen, dass die Europäer einen Teil der Last tragen.
Es ist klar, dass China in den kommenden Jahren eine größere Rolle für die NATO spielen und dabei den traditionellen Aufgabenbereich und das Territorium des Bündnisses neu definieren wird. Ein ideales Szenario für Washington wäre, wenn Europa auf seinem eigenen Kontinent die Stellung halten könnte (mit Unterstützung der Amerikaner), sodass die USA Ressourcen für ihr Engagement im Pazifik freisetzen könnten. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die neue US-Regierung europäischen Autonomiebestrebungen eher positiv gegenüberstehen wird – auch wenn dies in der Vergangenheit in Washington eher für Skepsis gesorgt hatte. Wenn gleichzeitig die EU-NATO- Beziehungen verbessert werden, könnte dies einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den europäischen Pfeiler in der NATO zu stärken.
Rüstungskontrolle unter Biden
Als Teil seines außen- und sicherheitspolitischen Programms will Joe Biden Amerikas Engagement für Rüstungskontrolle erneuern. Er tritt ein schweres Erbe an. Die Rüstungskontroll-Architektur, die gegen Ende des Kalten Kriegs und danach zwischen dem Westen und Russland entstanden und ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit im euro-atlantischen Raum war, ist schwer erschüttert. Russland hat fast alle Verträge gebrochen oder umgangen, die konventionelle Streitkräfte und Mittelstreckenwaffen betrafen. Erstmals seit über 30 Jahren wird Europa wieder atomar von russischem Territorium aus bedroht. Daraufhin kündigte US-Präsident Donald Trump den INF-Vertrag (Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-Vertrag), auch um Handlungsfreiheit gegenüber China zu erhalten, das Hunderte von Mittelstreckenwaffen besitzt. Er zog sich auch aus dem Abkommen über Open Skies zurück, das gegenseitige Aufklärungsflüge der OSZE-Staaten ermöglichte. Das New-START-Abkommen (Strategic Arms Reduction Talks) von 2010, das die strategischen Nuklearwaffen der USA und Russlands auf je 1.550 einsatzbereite Sprengköpfe und maximal 800 Trägersysteme begrenzt, ist das letzte noch intakte Rüstungskontrollabkommen. Am 5. Februar 2021 läuft der Vertrag aus, kann aber um bis zu fünf Jahre verlängert werden. Viel Zeit ist nicht mehr, um zu einer Einigung zu kommen.
Seit Juni verhandeln die Emissäre, für die USA Marshall Billingslea und für Russland Vize-Außenminister Sergej Ryabkow. Die USA streben ein neues Abkommen an, das alle Nuklearwaffen Russlands und der USA umfasst und China einbezieht. Eine Verlängerung von New START wollte Washington daran knüpfen, dass beide Seiten ihr gesamtes Arsenal auf dem jetzigen Stand einfrieren, einschließlich der sub-strategischen Waffen. China, das noch weit hinter Russland und den USA zurückliegt, wies das Ansinnen zurück. Auch Russland lehnte es ab. Ryabkow zufolge geht es der russischen Regierung um „strategische Stabilität als Ganzes“ und sie will wohl auch über amerikanische Raketenabwehrsysteme verhandeln. Kürzlich schlug Präsident Wladimir Putin vor, den New-START-Vertrag ohne Vorbedingungen um ein Jahr zu verlängern und dann weiter zu verhandeln. Dies lehnten die USA ab.
Die Lage ist also unklar, die Materie kompliziert. Bidens Experten werden sich rasch mit Billingslea abstimmen müssen. Biden hat erklärt, den Vertrag verlängern und als Grundlage für neue Rüstungskontrollvereinbarungen nutzen zu wollen. Der Vertrag würde denn auch die Zahl der geplanten neuen strategischen Nuklearwaffen Russlands, einschließlich eines extrem destabilisierenden Hyperschallgleitflugkörpers, überprüfbar begrenzen. Der Einschluss von sub-strategischen Waffen, bei denen Russland in Europa weit überlegen ist, wäre aus europäischer Sicht sehr zu begrüßen. Er muss aber zu einer verifizierbaren Reduzierung der Systeme im europäischen Teil Russlands führen, die Europa bedrohen können. Die Absicht Russlands, auch über ballistische Raketenabwehr zu verhandeln, tangiert das Sicherheitsinteresse der NATO, sich gegen mögliche Bedrohungen aus Drittstaaten zu schützen.
Biden hat auch angekündigt, Nuklearwaffen zu begrenzen und sie nur zur Abschreckung eines nuklearen Angriffs vorsehen zu wollen. Angesichts der russischen Doktrin, konventionelle Streitkräfte und Nuklearwaffen als integrierte operative Mittel zur Nötigung und regionalen Kriegsführung einzusetzen, muss aber die Glaubwürdigkeit der amerikanischen erweiterten Abschreckung für Europa erhalten bleiben – zur Verhinderung eines jeden Krieges und einer Drohung damit. Es geht also nicht nur um die Zahl von Atomsprengköpfen und Abschusssystemen, sondern auch um die damit verbundenen strategischen Optionen. Strategische Stabilität muss auch die Sicherheit Europas einbeziehen. Biden hat zugesichert, dass er seine Ziele „in consultation with the U.S. military and U.S. allies“ verfolgen wolle. Das ist ermutigend. Die Bundesregierung sollte sich auf einen intensiven Dialog vorbereiten und mit konstruktiven Vorschlägen aufwarten.
Aus europäischer Sicht sollte der New-START-Vertrag daher verlängert werden. Zugleich sollte er mit einer Verpflichtung verbunden werden, unmittelbar in Verhandlungen über einen Folgevertrag einzutreten, der zu weiteren Reduzierungen führt, die die Stabilität auch in Europa erhöhen.
Der Reformdruck auf UN-Friedensmissionen bleibt
Als größer Beitragszahler und ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sind die USA einer der wichtigsten Unterstützer von UN-Friedensmissionen. Für die Bundesregierung, die diese Einsätze als zentrales sicherheitspolitisches Handlungsinstrument in Krisensituation sieht, sind sie ein zentraler Partner.
Deutschland gehört seit Anfang 2019 und noch bis Ende des Jahres zu den nicht-ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat. In dieser Zeit arbeiteten deutsche Diplomaten relativ gut beim Thema Peacekeeping mit ihren US-Kollegen zusammen. Doch war die US-Position durch Spannungen zwischen einem erheblichem Kostendruck, der Skepsis der höchsten Ebene gegenüber multilateralen Lösungen und konstruktiver Unterstützung von Reformen der Friedensmissionen geprägt. In der Biden-Administration wird die Bundesregierung einen kohärenter agierenden Partner finden.
Druck übte die Trump-Regierung vor allem auf die Finanzierung von UN-Friedensmissionen aus. Trumps erste UN-Botschafterin Nikki Haley verfolgte das Ziel, den Peacekeeping-Haushalt der Vereinten Nationen deutlich zu senken. Damit einher gingen Sparmaßnahmen, strategische Überprüfungen von großen Missionen, die Anpassung von Mandaten und die Verkleinerung der UN-Truppenpräsenz in einigen Ländern. Die Gründe dafür waren teilweise nachvollziehbar, aber vor allem ging es Haley um Kostensenkungen.
Der UN-Peacekeeping-Haushalt fiel von 7,8 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt von Donald Trumps Amtsantritt auf 6,6 Milliarden Dollar für das aktuelle Haushaltsjahr 2020/21. Für die Vereinten Nationen wurde es immer schwieriger, ihre laufenden Kosten zu decken und die finanziellen Entschädigungen für truppen- und polizeistellende Länder pünktlich zu bezahlen. In den Haushaltsverhandlungen schlugen China und Russland Stellenstreichungen im Bereich Menschenrechte vor.
Die Biden-Administration wird aller Voraussicht nach den Finanzdruck auf den Haushalt der UN-Friedensmissionen etwas zurücknehmen, auch wenn sie dafür schwierige Verhandlungen mit dem US-Kongress führen muss. Das betrifft vor allem die knapp 1,3 Milliarden Dollar Schulden, welche die USA mittlerweile gegenüber dem UN-Haushalt für Friedensmissionen angehäuft haben (dieser ist separat vom regulären Haushalt). Unter Trump hatte die US-Regierung ihren Beitrag unilateral von den eigentlich vorgesehenen etwa 28 Prozent auf 25 Prozent des Haushalts reduziert. Biden wird in seinen Haushaltsverhandlungen mit dem Kongress auf Erfahrungen aus einer früheren UN-Budgetkrise zurückgreifen können: Als Senator erzielte er 1999 mit dem Helmes-Biden-Act eine parteiübergreifende Einigung, die es ermöglichte, einen Großteil der damals aufgelaufenen US-Schulden für den UN-Peacekeeping-Haushalt zu tilgen.
Insgesamt ist von Bidens Regierung mehr Kohärenz in der US-Politik zu UN-Friedensmissionen zu erwarten. Sie wird die Reformen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres für eine Stärkung von Rechenschaftspflicht, Leistung und Effizienz unterstützen. Auch im Bereich Friedensmissionen wird sich der Ton der US-Diplomatie verändern. In Trumps Amtszeit arbeiteten die US-Diplomaten mit Konfrontation und Ultimaten gegenüber den anderen Mitgliedsstaaten; die Repräsentanten der Biden-Administration dürften konzilianter auftreten. Als Biden noch Vizepräsident unter Präsident Barack Obama war, war er einer der Gastgeber eines Sondergipfels für das UN-Peacekeeping. Damals trug Biden wesentlich dazu bei, dass sich die UN-Mitgliedsstaaten bereit erklärten, mehr Truppen, insbesondere spezielle militärische Fähigkeiten, zu stellen und Reformen zu unterstützen.
Deutschland wird zwar ab 2021 nicht mehr im Sicherheitsrat vertreten sein, bleibt aber über seine finanziellen Beiträge, die diplomatische Begleitung, die Bundeswehrpräsenz bei UN-Missionen wie in Mali und Trainingsmaßnahmen für andere truppenstellende Nationen ein wichtiger Spieler für UN-Friedensmissionen. Die Bundesregierung sollte sich darauf einstellen, dass die USA unter Biden in all diesen Bereichen eine weitere Verstärkung des deutschen Engagements fordern könnten.
Außenpolitik/ Bilaterale Beziehungen
Geoökonomische Rivalität zwischen den USA und China
Die durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogene Weltwirtschaft kann sich nur wieder erholen, wenn das Virus weltweit besiegt wird – was eine globale Zusammenarbeit erfordern würde. Allerdings hat die Corona-Krise bestehende geoökonomische Rivalitäten verstärkt, insbesondere zwischen den USA und China. Damit wird Deutschland zu einer klaren Positionierung gezwungen.
Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie und deren sozialen und wirtschaftlichen Folgen versuchte Donald Trump im US-Wahlkampf, vom eigenen Versagen abzulenken und seine Wiederwahl zu sichern, indem er China für die Ausbreitung des „China“-Virus in den USA verantwortlich machte. Mit ihren Schuldzuweisungen rechtfertigte die Trump-Regierung eine noch härtere Gangart gegenüber China.
Auch wenn die USA unter einer Präsidentschaft von Joe Biden diplomatischer auftreten werden, wird sich an den geoökonomischen Kernpunkten der China-Politik wenig ändern. Nach dem Ansinnen Washingtons darf dem strategischen Rivalen China künftig nicht mehr durch wirtschaftlichen Austausch geholfen werden, ökonomisch und technologisch aufzusteigen. Vielmehr muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass China die USA in den technologischen Schlüsselbereichen überholt. Um Chinas ökonomische und militärische Modernisierung zu drosseln, forcieren die Vereinigten Staaten anstelle der bisherigen Politik der Einbindung und Integration eine Strategie der wirtschaftlichen Entkoppelung (decoupling).
Die Corona-Pandemie hat diesen De-Globalisierungstrend verstärkt. Immer mehr Firmen in den USA und Europa versuchen, auf Kosten der „Effizienz“, etwa der bisherigen international vernetzten „Just-in-time“-Produktion, mehr „Resilienz“ zu gewinnen. Dieses „Nearshoring“, „Reshoring“ oder die „Lokalisierung“ bedeuten, dass westliche Firmen ihre Lieferketten aus China wieder nach Hause verlagern. Einige Industriezweige, insbesondere im Technologie- und Pharmasektor, werden umso mehr unter Druck der Regierungen in den USA und anderswo geraten, dasselbe zu tun. Mit Argusaugen achtet insbesondere Washington darauf, dass die für seine strategischen Industrien wichtigen Lieferketten von China unabhängiger werden.
Steigende chinesisch-amerikanische Spannungen werden nicht nur spaltende Wirkung auf multilaterale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO), sondern auch erhebliche Auswirkungen auf „Dual Options“-Länder wie Deutschland haben. Denn diese haben starke nationale Sicherheitsbeziehungen zu den USA, aber pflegen ebenso umfangreiche wirtschaftliche Beziehungen mit den USA und China. Die Kosten dieser Doppel-Strategie werden in Zukunft steigen, wie dies bereits im Technologiesektor deutlich wird (zum Beispiel 5G/Huawei). In dem Ringen um technopolitische Einflusssphären werden die USA den Druck auf Drittstaaten verstärken und sie vor die Wahl stellen, entweder mit Amerika oder mit China Geschäfte zu betreiben. Eine in chinesische und amerikanische Standards und Systeme zweigeteilte Welt ist die Folge.
Äquidistanz zwischen den USA und China oder gar eine stärkere Annäherung an China wären schon wegen der Werte-Distanz zu China und der sicherheitspolitischen Abhängigkeit Deutschlands und Europas von den USA in keinem Fall sinnvolle Optionen.
Deutschland wäre gut beraten, im Schulterschluss mit Frankreich Europas Wirtschafts- und Währungsunion durch eine politische Union zu finalisieren. Die Europäische Union ist in besonderem Maße anfällig für die „teile und beherrsche“-Strategien der Großmächte, allen voran Chinas und der USA. Um ihre politische Anfälligkeit zu überwinden und ihre Handlungsfähigkeit zu verbessern, sollte die EU in der Außen- und Sicherheitspolitik von der Illusion der Einstimmigkeit hin zu einer realistischeren Konsensfindung in Form einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung kommen.
US-Russland-Beziehungen: Kein Reset, aber neue Möglichkeiten eröffnet
Die Aussichten auf eine Verbesserung der amerikanisch-russischen Beziehungen sind gering. Sollte Joe Biden der nächste Präsident werden, wird er den Dialog mit Moskau illusionslos führen. Eine längere Übergangsperiode, anhaltende innenpolitische Spaltungen und eine Priorisierung Chinas könnten jedoch seine Bemühungen um eine kohärente US-amerikanische Russlandpolitik weiter behindern.
Die US-Präsidentschaftswahl war vor allem von innenpolitischen Fragen und dem Umgang mit der Coronavirus-Pandemie geprägt. Anders als vor vier Jahren wurde das Thema Russland im Wahlkampf weitgehend ausgeklammert, obwohl US-amerikanische Beamte über frühere russische Bemühungen berichtet haben, in Dutzende von staatlichen und lokalen Regierungsnetzwerken einzudringen.
Selbst eine längere Übergangsperiode in Washington wird aufgrund des strategischen Umfangs und der Langfristigkeit der gegenwärtigen Probleme keine Komplikationen in den bilateralen Beziehungen verursachen. Joe Biden übt seit langem scharfe Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hat wiederholt erklärt, dass die größte Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nicht China, sondern Russland sei. Sein Ansatz könnte für Frankreich und andere EU-Länder, die auf eine Erneuerung pragmatischer Beziehungen und des Sicherheitsdialogs mit Moskau hoffen, ein Problem darstellen. Ein Dialog darüber, wie man Russland gemeinsam begegnen kann, könnte sich jedoch anbahnen.
Vorhersehbare Probleme
Nukleare Rüstungskontrolle
Das wichtigste und drängendste Thema ist die Verlängerung des „New START“-Vertrags, des einzigen verbleibenden amerikanisch-russischen Atomwaffenkontrollabkommens. Dieses ist noch in Kraft und läuft am 5. Februar 2021 aus. Eine Verlängerung um ein Jahr ist wahrscheinlich, ebenso wie diplomatische Bemühungen um einen neuen Vertrag. Eine gescheiterte Verlängerung wird schlechte Auswirkungen auf die Sicherheit Europas haben. Europa sollte daher versuchen, Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen.
Energiesicherheit
Die Biden-Regierung wird Europa voraussichtlich weiterhin dazu drängen, seine Abhängigkeit von russischen Energieressourcen zu verringern. Dies gilt insbesondere für Erdgas, da die USA auch künftig ihren Schiefergasexport als – allerdings teurere – Alternative anbieten werden.
Zukünftige Möglichkeiten und gemeinsames transatlantisches Interesse
Stärkung des Multilateralismus
Die Beziehungen zu Russland sind auch mit zwei zentralen Elementen Bidens umfassenderer außenpolitischer Strategie verbunden: 1) des Wiederaufbaus von Bündnissen, die durch Trumps unilateralen Ansatz beschädigt wurden, einschließlich der NATO; und 2) einer Wiederbelebung der internationalen Solidarität unter Demokratien gegenüber der Flut autoritärer Regime, die Russland und China gestärkt hat.
Klimawandel
Die Bekämpfung des Klimawandels und die Bewältigung seiner Folgen dürften eine Option für Zusammenarbeit zwischen den USA, Russland und der EU bieten, da die nördlichen Regionen Russlands, einschließlich Teilen seiner Energieinfrastruktur, von den negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung stark betroffen sind.
Die Arktis
Kurzfristig ist es für die USA nicht realistisch, der regionalen militärischen Überlegenheit Russlands und Moskaus Absicht, militärische Gewalt zu politischen Zwecken einzusetzen, entgegenzutreten. Daher wird die Biden-Regierung voraussichtlich multilateral einen diplomatischen Ansatz befördern, um Spannungen in der Arktis weiterhin zu vermeiden.
Moskaus Beeinflussungsversuchen entgegentreten
Eine neue Biden-Administration wird sich höchstwahrscheinlich deutlich stärker mit den verschiedenen Beeinflussungsversuchen Moskaus befassen als Washington in den letzten vier Jahren. Dies gilt in erster Linie für die Beeinflussungsversuche innerhalb der Vereinigten Staaten selbst. Aber auch die NATO-Verbündeten - darunter Deutschland - können möglicherweise auf die Unterstützung Washingtons zählen, wenn es darum geht, den bestehenden russischen hybriden Anstrengungen entgegenzuwirken und künftigen vorzubeugen.
Regionale Sicherheit in der postsowjetischen Region
Das begrenzte Engagement der Trump-Administration in der Region wird wahrscheinlich durch eine aktivere US-amerikanische Diplomatie ersetzt werden. Die Ukraine wird von vielen Mitgliedern des Biden-Teams als ein Land von zentraler strategischer Bedeutung wahrgenommen, was den Weg für eine Wiederbelebung des politischen Dialogs mit der EU und Deutschland ebnet. Eine weitere Gelegenheit für intensiveren Dialog bietet sich in Belarus. Während die neue Regierung in Washington ihr Amt wahrscheinlich zu spät antreten wird, um zu einer effizienten Beilegung der jüngsten Eskalation in Berg-Karabach beizutragen, könnte die Bewältigung der humanitären Folgen der Krise einen weiteren Bereich für eine enge Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen und -Regierungen bieten.
Empfehlungen für europäische Entscheidungsträger
- Das vorrangige außenpolitische Ziel jeder neuen US-Regierung wird der Umgang mit einem aufstrebenden und zunehmend autokratischen China sein. Welche Rolle Russland in diesem strategischen Kontext spielen könnte, bleibt abzuwarten.
- Ein entscheidender Faktor zur Abschreckung weiterer russischer Versuche, Europa zu spalten, wird eine wiedererstarkte NATO sein. Die europäischen Regierungen sollten bereit sein, politisch, militärisch und finanziell in sie zu investieren.
Da unklar ist, ob die Wiederherstellung des Vertrauens im Inneren Raum für eine aktivere US-amerikanische Außenpolitik lassen wird, muss Europa (und insbesondere Deutschland) bereit sein, einen größeren Teil der regionalen Sicherheit zu verantworten. Es wird nicht einfach sein, das relative Machtvakuum zu füllen, das die Trump-Regierung in der europäischen Nachbarschaft hinterlassen hat. Dies würde jedoch auch die Möglichkeiten für einen Dialog mit Moskau verbessern. Unter einer Biden-Regierung könnte Berlin auf breitere Unterstützung aus Washington zählen, um mehr Verantwortung zu übernehmen.
Iran: Europa muss – und kann – zwischen Washington und Teheran vermitteln
Unter Präsident Joe Biden kann der Wiedereintritt der USA in das Nuklearabkommen von 2015 möglich werden. Trotzdem wird es keine Rückkehr zu der besonderen diplomatischen Konstellation von vor fünf Jahren geben. Zu tief sitzt das Misstrauen zwischen Teheran und Washington nach der einseitigen Aufkündigung durch Präsident Donald Trump. Auch hat es im Nahen Osten signifikante Machtverschiebungen gegeben, welche die zu Beginn der letzten Dekade erfolgreiche „Kompartimentierung“ – sprich: die separate Behandlung von Konfliktfeldern – nicht mehr als realistisch erscheinen lassen. Und schließlich mussten die Europäer in den letzten Jahren erkennen, wie beschränkt ihre Handlungsmöglichkeiten in der Iranpolitik sind.
Zwar erklärte Biden bereits im Wahlkampf seine Absicht, das Atomabkommen wieder zu aktivieren, sofern sich auch Iran wieder an seine Verpflichtungen hält. Doch haben beide Seiten wenig Spielraum. Bidens Administration wird ihren Fokus auf innenpolitische Belange („building back better“) richten müssen. Iran wiederum wird nach Jahren des „maximalen Drucks“ aus Washington nur wenige Zugeständnisse machen wollen, zumal angesichts der iranischen Präsidentschaftswahlen im Juni 2021. Eher wird das Land noch Entschädigungen für die harschen US-Sanktionen verlangen. Das wiederum wäre für die USA inakzeptabel. Für sie ist eine schnelle Einigung auf die beiderseitige Einhaltung des Abkommens eher eine „low-hanging fruit“ als eine echte Priorität.
In der Region selbst hat Iran in den vergangenen Jahren seine Position am Persischen Golf ausbauen können, wie das Land in diversen Stellvertreterkriegen sowie mit Angriffen auf Öleinrichtungen seiner Nachbarn demonstrierte. Neben der im Syrien-Krieg entstandenen Waffenbrüderschaft mit Russland hat Iran mittlerweile enge Bande zu China geknüpft. Im Sommer wurde die Unterzeichnung einer auf 25 Jahre angelegten Partnerschaft mit Peking bekannt, die neben Milliardeninvestitionen in die iranische Öl- und Gaswirtschaft auch eine enge militärische Zusammenarbeit vorsieht.
Gleichzeitig hat sich mit Israel ein regionaler Gegenspieler Irans behauptet, der weder in Syrien noch im Cyberspace die bilaterale Konfrontation mit Teheran scheut. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain hat Israel sogar neue Verbündete gewonnen. Letztere wiederum sahen sich durch die USA – ob unter Barack Obama oder Donald Trump – nicht ausreichend geschützt.
Wie prekär die regionale Lage ist, zeigt sich auch an der Eskalation im Norden: Der Krieg um Berg-Karabach kann nicht nur zu einer Konfrontation zwischen der Türkei und Russland führen, sondern bedroht auch die Stabilität der angrenzenden iranischen Provinzen. Diese volatile Lage sowie die unterschiedlichen Interessen der Großmächte machen es wenig wahrscheinlich, dass sich Russland und China wie zwischen 2006 und 2015 mit Nebenrollen am Verhandlungstisch zufrieden geben werden.
Die Europäer haben es zwar vermocht, entgegen allen Erwartungen das Atomabkommen am Leben zu erhalten. Ihnen gelang es sogar, die jüngsten Versuche der Trump-Administration abzuwehren, alle UN-Sanktionen gegen Iran wiedereinzusetzen („snapback“). In wirtschaftlichen Fragen ist ihre Abhängigkeit von Washington allerdings überdeutlich geworden. Trotzdem wird Teheran trotz aller Enttäuschung über die mangelnde Eigenständigkeit der Europäer im Zweifelsfall weiter mit ihnen zusammenarbeiten wollen.
Dies gilt zumal, wenn Europa sich mit der neuen US-Administration auf einen gemeinsamen Kurs einigen kann. Dieser transatlantische Ansatz sieht intensive, aber begrenzte Verhandlungen zur Wiederherstellung des Atomabkommens direkt nach Bidens Amtseinführung vor. Hier müssen die Europäer in ihre klassische Vermittlerrolle zwischen Washington und Teheran schlüpfen, um die Chancen für eine Einigung auszuloten.
Nach der Wahl eines neuen – vermutlich sehr konservativen – iranischen Präsidenten folgt im zweiten Halbjahr 2021 der noch schwierigere Teil, für den europäische Kreativität und Ganzheitlichkeit gefragt sind. Denn dann wird es darum gehen, durch Verhandlungen und vertrauensbildende Maßnahmen die regionale Dimension von Stellvertreterkriegen und die gegenseitigen Bedrohungswahrnehmungen zu adressieren. Auf dem Weg dorthin könnten erste Kooperationsschritte in der Pandemiebekämpfung, bei Migrations- und Umweltfragen helfen, belastbare Kanäle zwischen den verfeindeten Staaten zu etablieren.
Ein derart breit angelegtes Programm wäre im grundsätzlichen europäischen Interesse. Mit Unterstützung durch eine Biden-Administration hat es zudem Chancen, mittelfristig umgesetzt zu werden.
Lateinamerika: Rückkehr zur Politik der guten Nachbarschaft
Die meisten lateinamerikanischen Regierungen werden den Machtwechsel im Weißen Haus begrüßen, aber nicht alle. Denn die Trump-Administration hatte über Korruption und Menschenrechtsverletzungen befreundeter Regierungen (vor allem in Zentralamerika, aber auch in Kolumbien und Brasilien) großzügig hinweggeschaut. Und für den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro war US-Präsident Donald Trump das große Vorbild.
Die USA werden unter Präsident Joe Biden zu einer Politik der guten Nachbarschaft zurückkehren wie sie bereits Präsident Barack Obama betrieben hatte. Allerdings werden einige Entscheidungen der Trump-Administration nachwirken. So wird Präsident Biden sicherlich nicht den Grenzzaun zu Mexiko einreißen und sich davor hüten, einen grundlegenden Wandel in der Einwanderungspolitik gegenüber Mexiko und Zentralamerika zu signalisieren. Auch das United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) als Nachfolger des NAFTA-Vertrages wird in seiner jetzigen Form fortbestehen.
Auch unter Präsident Biden werden die USA bestrebt sein, den Einfluss Chinas in Lateinamerika zurückzudrängen, was aber aufgrund der bestehenden Handelsstrukturen schwierig sein dürfte. Biden könnte einige der von Trump initiierten Programme fortführen (wie etwa Growth in the Americas), um mit China bei Infrastruktur-Projekten in Lateinamerika konkurrieren zu können. Die USA werden dies bilateral, aber auch multilateral etwa über die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB) umsetzen. Wenn auch nicht von Biden gebilligt, könnte die von Trump durchgesetzte Besetzung des Präsidentenpostens der IDB durch einen US-Amerikaner von Vorteil sein.
Lateinamerika ist besonders hart von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie betroffen. Die USA haben (zusammen mit Brasilien) ein negatives Beispiel für die Region abgegeben und während der Pandemie u.a. Mittel für die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) zurückgehalten. Unter Präsident Biden werden die USA stärker mit Lateinamerika bei der Bewältigung der Pandemie kooperieren (etwa bei einer zweiten Welle oder der Verteilung von Impfstoff). Hier ergeben sich auch Möglichkeiten für eine breitere Kooperation zusammen mit Europa.
Mit Biden erhöhen sich die Chancen, dass die europäische und die US-amerikanische Lateinamerika-Politik für die gleichen oder ähnliche Ziele eintritt. Im Hinblick auf Venezuela werden die USA ihre Sanktionen beibehalten, aber sich möglicherweise mehr mit Partnern in Lateinamerika und Europa abstimmen. Gleiches gilt für Nikaragua. In ihrer Kuba-Politik wird die Biden-Administration wieder auf Wandel durch Annäherung setzen und einige Maßnahmen der Trump-Administration zurücknehmen. Europa und die USA könnten gemeinsam auf eine konstruktive Haltung Kubas in der Venezuela-Krise hinwirken.
Es ist zu erwarten, dass die Biden-Regierung ein stärkeres Engagement in Zentralamerika zeigen wird, um das Problem der Migration aus der Region in den Ländern selbst anzugehen. Dazu dürften wirtschaftliche Anreize gehören, aber auch eine Fokussierung auf die Stärkung des Rechtstaats und die Bekämpfung der Korruption. In diesen Bereichen könnten sich Maßnahmen der USA und Europas positiv ergänzen.
Unter Biden wird der Klimaschutz wieder größere Bedeutung erlangen. Konflikte mit der brasilianischen Regierung sind vorgezeichnet. Beim Schutz des Amazonas-Regenwaldes könnten Europa und die USA zukünftig stärker kooperieren und gemeinsam Druck auf die brasilianische Regierung ausüben.
Die Politik der USA zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Präsenz in Lateinamerika ist zwar vor allem gegen China gerichtet. Sie könnte aber auch europäische Interessen tangieren, wenn die USA versuchen, Präferenzen für ihre Unternehmen zu erwirken. Die EU ist deshalb gut beraten, auch unter Präsident Biden ihre wirtschaftlichen Interessen in Lateinamerika eigenständig gegenüber den USA und China abzusichern (etwa über das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur).
US-Afrika-Beziehungen: Ein respektvollerer Umgang mit Afrika
Mit Joe Biden wird ein wesentlich konventionellerer diplomatischer Stil in die US-Außenpolitik zurückkehren. Gerade am Umgang mit dem afrikanischen Kontinent wird sich dies deutlich zeigen. Donald Trump erzürnte afrikanische Bevölkerungen mit abfälligen und rassistischen Äußerungen und dem Einreisestopp für Angehörige einiger muslimisch dominierter Länder. Afrikanische Staats- und Regierungschefs traf er nur selten; den Kontinent besuchte er während seiner Amtszeit nicht ein einziges Mal.
Mit seiner einseitigen Parteinahme für Ägypten im Nilwasserstreit um den Grand Ethiopia Renaissance Dam unterminierte Trump die Rolle der USA als Vermittler in dem Konflikt. Im Umgang mit dem historischen Übergangsprozess in Sudan drängte er aus innenpolitischen Gründen auf eine Normalisierung von Sudans Beziehungen zu Israel. Für ihn war dies Vorbedingung, um Sudan von der US-Liste der Terrorismus fördernden Länder zu streichen. In Sudan empfand man es als Erpressung.
Biden machte bereits im Wahlkampf deutlich, dass er sich entschieden von solcher Politik absetzen will. So organisierte sein Wahlkampfteam eine eigene Veranstaltung mit dem Fokus auf die künftige amerikanische Afrika-Politik. Die außenpolitischen Expertinnen und Experten in Trumps Berater- und wahrscheinlichem Regierungsteam betonten, dass Biden beschädigte Beziehungen reparieren wolle.
Aus Sicht Europas ist der respektvollere Ton zu begrüßen. Allerdings wird es auch mit einer Biden-Administration inhaltliche Differenzen im Umgang mit Afrika geben. Während Biden weniger platt und transaktional vorgehen wird, werden geopolitische Faktoren, allen voran die Konkurrenz mit dem autoritären China, sich auch in seiner Afrika-Politik widerspiegeln. Biden hat angekündigt, demokratische Regierungen als besondere Partner zu behandeln; es bleibt abzuwarten, ob das auch gilt, wenn diese von chinesischen Infrastrukturinvestitionen profitieren wollen.
Biden wird das gebeutelte State Department, dessen Diplomatinnen und Diplomaten mit Afrika-Expertise reihenweise kündigten, wiederaufzubauen suchen. Wer den diplomatischen Chefsessel einnimmt und wer Assistant Secretary of State for African Affairs wird, spielt eine besondere Rolle für die US-Afrika-Beziehungen. Regierungserfahrene Mitglieder seines Teams wie Susan Rice, nationale Sicherheitsberaterin unter Präsident Barack Obama, würden mit ihren umfangreichen Netzwerken und Beziehungen in Afrika auch eigene blinde Flecken mit sich bringen. So nahm Rice afrikanische Präsidenten, die sie als langjährige Partner schätzte, vor Kritik durch die USA oder die Vereinten Nationen in Schutz. Dazu zählten Ugandas Yoweri Museveni, Ruandas Paul Kagame und Südsudans Salva Kiir Mayardit – allesamt autokratische Herrscher.
Dennoch ist klar, dass aus europäischer Sicht mit der Biden-Administration ein verbindlicher, ähnlich gesinnter Partner auf die diplomatische Bühne zurückkehrt. Dies betrifft gerade wichtige multilaterale Themen, die auch für die europäischen Beziehungen mit den afrikanischen Ländern wichtig sind: die Bekämpfung des Klimawandels, die Neustrukturierung von Staatsschulden sowie Solidarität in der Finanzierung und Verteilung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2, sobald dieser verfügbar ist.
Während Trump Pläne ausarbeiten ließ, um die zur Terrorismusbekämpfung nach Somalia und in die zentrale Sahelzone entsandten US-Truppen abzuziehen, ist von Biden zumindest mehr Umsicht zu erwarten. Doch auch Biden hat angekündigt, die US-Beteiligung an „forever wars“ zu beenden. Die Europäer, die größten Geber für die AU-Mission AMISOM in Somalia und selbst militärisch stark in der Sahelzone involviert, werden sich auf Dauer mit einer reduzierten Rolle des US-Militärs in diesen Krisengebieten abfinden müssen. Dafür können sie mit Biden im Weißen Haus auf einen Partner für Diplomatie und Krisenprävention zählen, nicht nur in Afrika.
Migrationspolitik: Vier Hürden für Biden, zwei Chancen für Deutschland
Die Migrationsbilanz von US-Präsident Donald Trump lässt viele Deutsche und Amerikaner gleichermaßen erschauern. Er hat das Asylsystem bis zur Unkenntlichkeit beschnitten und Menschen in inoffizielle Flüchtlingscamps in Mexiko zurückgeschickt. Er hat Kinder in Käfige sperren lassen – die Bilder der Familientrennungen an der Grenze sorgten für einen internationalen Aufschrei. Geschätzt weniger als 20.000 Flüchtlinge kommen derzeit im Jahr ins Land. Das ist ein historischer Tiefstand. Trump hat selbst Hochqualifizierten das Leben schwer gemacht, indem er das Programm eingeschränkt hat, mit dem ironischerweise einst seine Frau ins Land kam. Im Angesicht dieses Katalogs der Abschottung mutet der Bau des Grenzzauns zu Mexiko, sein zentrales Wahlversprechen 2016, geradezu moderat an.
Mit dem Sieg von Joe Biden verbinden viele die Hoffnung, dass sich dieser Trend umkehrt. Als Gegenprogramm zu Trump hat Biden bereits im Wahlkampf angekündigt, pro Jahr 125.000 Flüchtlinge ins Land zu holen. Er will das umstrittene „Bleib in Mexiko“-Programm abschaffen und die sogenannten Dreamer in den USA schützen. Die Asylzugänge will Biden wieder verbreitern, genauso wie die legalen Wege zur Migration. Außerdem will er die Aufsicht über die Immigrations- und Zollbehörde (ICE) erhöhen, die für ihre oft rabiate Abschiebepraxis in der Kritik steht.
Doch es ist unwahrscheinlich, dass Biden seine Pläne tatsächlich schnell oder umfassend in die Tat umsetzen kann. Das hat vier Gründe. Erstens werden für Biden die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise zunächst wichtiger sein als das Thema Migration.
Der zweite Grund ist das Zwiebelprinzip der Trumpschen Migrationspolitik. Trump setzte seine Agenda nicht nur mit Präsidentialerlässen um, die Biden teils mit ein paar Federstrichen aufheben kann, sondern auch mit anderen vielschichtigen Maßnahmen, die nur schwer einzeln weggeschält werden können. Dazu gehören Regularien, deren Änderungen Monate dauern können, Maßnahmen, die nur der Justizminister und nicht das Weiße Haus vornehmen kann, und außenpolitische Vereinbarungen mit Mexiko und mittelamerikanischen Ländern.
Drittens wird ein konservativer Supreme Court die strittigen Immigrationsfragen der Zukunft entscheiden. Das Oberste Gericht, geprägt durch die von Trump ernannten Richter, wird voraussichtlich allzu liberalen Präsidentialerlässen einen Riegel vorschieben.
Viertens hat die Integrations-Infrastruktur Schaden genommen. Hunderte von Agenturen, die die Integration ankommender Flüchtlinge ermöglichen, mussten mangels neuer Ankünfte Mitarbeiter entlassen oder gar schließen. Selbst wenn Biden wie geplant die Umsiedlungszahlen versechsfacht, wird der Wiederaufbau dieser Agenturen lange dauern. Auch Deutschland musste schmerzlich erfahren: Willkommenskultur ohne die nötige Willkommensinfrastruktur bringt Probleme.
Chance auf Migrationsdialog zwischen den USA und Deutschland
Für Deutschland gibt es zwei Schlussfolgerungen. Erstens sollten die Lektion der USA ernst genommen werden: Wenn Populisten die Steuerung von Migrationssystemen übernehmen, ist der Schaden schwer wieder auszubügeln.
Zweitens muss Migration endlich als strategisches Politikfeld angesehen werden, in dem Deutschland im Gegensatz zu Sicherheit und Wirtschaft nicht nur der Juniorpartner der USA ist, sondern tatsächlich ebenbürtig. Seit Jahren werden die Herausforderungen auf beiden Seiten des Atlantiks immer ähnlicher, doch der Austausch zwischen Deutschland und den USA zu Migration steckt nach wie vor in den Kinderschuhen. Beide Länder brauchen einen strukturierten Dialog, um aus den Fehlern des anderen zu lernen und neue globale Lösungen zu testen. Unter Biden kann ein Migrationsdialog endlich frischen Wind in die US-deutschen Beziehungen bringen.