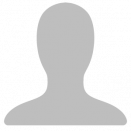Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die Gleichgewichte innerhalb der EU, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich?
Claire Demesmay: Das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs, so eine verbreitete Meinung in Frankreich, soll für die EU einen neuen Kurs ermöglichen. Präsident Hollande vergleicht den Brexit zwar mit einem Erdbeben, gleichzeitig sieht er darin eine Gelegenheit, Frankreich Gehör zu verschaffen und seine Rolle in der Europapolitik zu stärken. Das Versprechen eines „anderen“ Europas, womit er 2012 in den Wahlkampf zog, konnte er nicht umsetzen – was das linke Lager ihm bis heute vorwirft. Nun sieht er seine Zeit gekommen. Hollande fordert eine stärkere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch, wie schon 2012, mehr Investitionen in Wachstum und Arbeit sowie eine Harmonisierung der Steuerpolitik. Nicht zuletzt soll dadurch die deutsch-französische Zusammenarbeit wieder an Symmetrie gewinnen.
Ausgerechnet sie wird durch den Brexit geschwächt: Das britische Beharren auf einem liberalen Kurs in der Europapolitik war oft Grundvoraussetzung für eine enge Kooperation zwischen Deutschen und Franzosen – und förderte indirekt den Integrationsprozess. Deutschland konnte sich gemeinsam mit Frankreich für die politische Integration der EU einsetzen, weil es für die Vertiefung des Binnenmarktes einen britischen Verbündeten hatte. Dass ein deutsch-französisches Tête-à-Tête nach dem Brexit einen Integrationssprung schafft, ist insofern unwahrscheinlich. Umso mehr, als die Interessen beider Länder zurzeit stark divergieren.
Jana Puglierin und Julian Rappold: Für Deutschland hat der britische Austritt weitreichende wirtschaftliche und politische Folgen. Das Vereinigte Königreich ist sein drittgrößter Handelspartner. Die Unsicherheit über die zukünftige Anbindung des Landes an den europäischen Binnenmarkt wird die britisch-deutschen Handelsbeziehungen belasten und das deutsche Wirtschaftswachstum hemmen. Zudem wird Deutschland einen Großteil des britischen Beitrags zum EU-Budget von jährlich sieben Milliarden Euro stemmen müssen.
Viel schwieriger wiegt, dass Deutschland einen gewichtigen Verbündeten verliert, wenn es in der EU darum geht, für freie Märkte, Bürokratieabbau und Deregulierung zu streiten. Mit dem britischen Entscheid verschieben sich die Kräfteverhältnisse im Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN) zugunsten jener Staaten, die sich für eine eher etatistische, interventionistische Wirtschaftspolitik einsetzen. Das Pendel zwischen deutscher „Ordnungspolitik“ und französischem „Interventionnisme“ droht in Richtung Frankreich zu schwingen. In der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik wird der Druck auf Deutschland, Verantwortung und Führung zu übernehmen, weiter zunehmen.
Die Erwartungen an Deutschland, den Rest der EU zusammenzuhalten, sind hoch. Gleichzeitig sehen viele in der deutschen Dominanz keine Lösung, sondern betrachten sie als Teil des Problems.
Was ist die Sicht der Visegrád-Staaten, von woher man so viel Kritik an der EU hört?
Gereon Schuch: Auch Warschau und Budapest sehen es kritisch, dass Deutschland mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs an Gewicht gewinnt, denn sie verstehen London als Gegenpol zum deutschen Drang nach Vertiefung in der EU. So hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vor dem Referendum sogar eine persönlich unterzeichnete Anzeige in der britischen Presse geschaltet: „Ich will Sie wissen lassen, dass Ungarn stolz ist, mit Ihnen gemeinsam der Europäischen Union anzugehören.“ Diese Stellungnahme eines ausländischen Regierungschefs im Wahlkampf eines nationalen Referendums ist bemerkenswert. Der polnische Präsident Andrzej Duda drückte sein klares Bedauern über das Ergebnis vom Freitag aus. Auch die tschechische Regierung zeigte keinerlei Freude, wenngleich sie das britische Votum als Bestätigung der Forderungen nach einer EU-Reform betrachtet. Die Frage ist nun, inwieweit die Visegrád-Staaten eine gemeinsame, konstruktive Position zur Zukunft der EU entwickeln können, um ihrer Stimme damit Gewicht zu verleihen.
Hinzu kommt in den Visegrád-Ländern die Sorge um den Status und die Zukunft der eigenen Landsleute im Vereinigten Königreich. Mit der EU-Osterweiterung und der Arbeitnehmerfreizügigkeit setzte eine erhebliche Arbeitsmigration ein, rund eine dreiviertel Million Polen und um die 200 000 Ungarn sind im Vereinigten Königreich berufstätig. Insgesamt nimmt der östliche Teil der EU die britische Entscheidung also nicht mit Jubel, sondern mit Verunsicherung und Unbehagen auf – wenngleich sich die Stimmen bestätigt sehen, die fordern, dass sich in der EU etwas ändern müsse, um die Menschen wieder für dieses Projekt zu begeistern.
Ist der Brexit ein „Sieg Putins“?
Stefan Meister: Grundsätzlich wird übertrieben dargestellt, welche Rolle Russland im Vorfeld der Abstimmung gespielt haben soll und welche Bedeutung diese für Russlands Politik gegenüber der EU hat. Es ist kein aktiver Sieg Putins, aber für die russische Führung könnten sich daraus indirekte Vorteile ergeben. Erstens werden die EU-Mitgliedstaaten und insbesondere Deutschland weniger Ressourcen für die Lösung des Ukrainekonfliktes haben und sich noch mehr mit internem EU-Krisenmanagement beschäftigen müssen. Zweitens verlässt ein Land die EU, das konsequent die Sanktionspolitik gegenüber Russland unterstützt hat und für einen harten Umgang mit Moskau steht. Drittens ist das Vereinigte Königreich bezüglich Sicherheitsgarantien und dem Verhältnis zu Washington eines der wichtigsten Länder in der EU.
Der Brexit verbessert die russische Verhandlungsposition gegenüber der EU in der Ukrainekrise; er bindet Ressourcen der Mitgliedstaaten, die im Umgang mit der russischen Führung gebraucht würden. Weniger Aufmerksamkeit für die Ukraine und ein wachsendes Interesse an einem neuen Modus Vivendi mit Moskau könnten die Folge sein. Gleichzeitig bestätigt der britische Austritt das Paradigma russischer Propaganda, dass die EU kein Modell mehr für Russland ist, dass sie keine Zukunft hat und nur Putin Stabilität garantiert.
Aber all das hat nichts mit einer aktiven Schwächung der EU durch Moskau zu tun, sondern mit einem selbstverschuldeten Reformstau in den Mitgliedstaaten, unverantwortlichen Eliten und einer wachsenden Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft. Dafür der russischen Führung eine Mitschuld zu geben, ist schlichtweg falsch.
Was bedeutet der Brexit für die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen USA und Europa?
Henning Riecke: Trotz aller Beteuerungen von amerikanischer Seite, an der „Special Relationship“ festhalten zu wollen, verliert diese durch den Brexit an Substanz. Um Einfluss in der EU zu gewinnen, müssen sich die USA jetzt stärker auf Deutschland und vielleicht Frankreich konzentrieren. Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs untergräbt den Anspruch der EU, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik als einheitlicher Akteur aufzutreten. Ein Bündnis, aus dem Mitglieder freiwillig austreten, erscheint kaum als starke Gruppierung. Unabhängig davon, inwieweit das Vereinigte Königreich auch künftig zu EU-Missionen beiträgt, wird das die Erwartungen an Europa als Stabilitätsexporteur und Krisenmanager weiter dämpfen. Das wird sich auch auf die Bedeutung Europas für die USA auswirken.
Das Vereinigte Königreich galt in der europäischen Debatte immer als der Mitgliedstaat mit den klarsten Vorstellungen zu einer militärischen Rolle in der Außenpolitik. Insofern verändert sich auch, wie die Europäische Union in ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik Kompromisse finden kann. Neue Strukturen wie ein operatives Hauptquartier, das die Briten immer gern verhindert haben, sind nun vorstellbar; doch würden eben die Briten als Impulsgeber fehlen, wenn es um konkrete Einsätze geht. Insgesamt verspricht der britische Ausstieg eine noch zivilere und bescheidenere Ausrichtung der GSVP.
In der NATO könnte der Brexit einen Stimmungswandel verstärken. Frustration der USA über ungerechte Lastenteilung und militärische Ineffizienz der Europäer sind ein Dauerthema. Von Donald Trump, der den europäischen Trittbrettfahrern schon den Rückzug aus der Allianz angedroht hat, aber auch von Hillary Clinton dürfte eine härtere Linie zu erwarten sein. Die Briten könnten sich in dieser Frage auf die amerikanische Seite schlagen – was auch die Annäherung zwischen NATO und EU nicht leichter machen wird.
Wie sieht China die EU nach dem Brexit?
Eberhard Sandschneider: Seit Jahren erfreut sich chinesische Politik gegenüber Europa einer erfolgreichen Strategie des divide et impera. Daran wird auch der britische Entscheid wenig ändern. London als Finanzzentrum ist natürlich ein wichtiger Standort, wie man im vergangenen Jahr beim Besuch des chinesischen Präsidenten sah. Mindestens ebenso wichtig ist aus chinesischer Sicht jedoch Berlin. Dass nach dem britischen Ausscheiden Deutschland eine noch größere Rolle in der Europäischen Union zukommen wird, ist aus chinesischer Sicht nicht abschreckend.
Für China sind strategisch zwei Dinge wichtig: Der wirtschaftliche Austausch mit Europa, einschließlich der verstärkten Rolle chinesischer Investoren beim Versuch, europäische Technologie stärker an chinesische Unternehmen zu binden; und der Erhalt der EU als Ganzem und als Gegengewicht zu den USA. Sieht man von den kurzfristigen Irritationen an den Finanzmärkten ab, bleibt aus chinesischer Sicht beides als erreichbares Ziel bestehen.