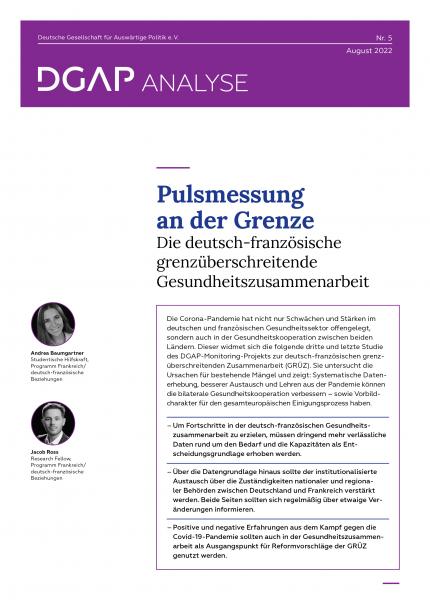|
Empfehlungen |
|---|
|
Um Fortschritte in der deutsch-französischen Gesundheitszusammenarbeit zu erzielen, müssen dringend mehr verlässliche Daten rund um den Bedarf und die Kapazitäten als Entscheidungsgrundlage erhoben werden. |
| Über die Datengrundlage hinaus sollte der institutionalisierte Austausch über die Zuständigkeiten nationaler und regionaler Behörden zwischen Deutschland und Frankreich verstärkt werden. Beide Seiten sollten sich regelmäßig über etwaige Veränderungen informieren. |
| Positive und negative Erfahrungen aus dem Kampf gegen die Covid-19-Pandemie sollten auch in der Gesundheitszusammenarbeit als Ausgangspunkt für Reformvorschläge der GRÜZ genutzt werden. |
Der vollständige Text inklusive Fußnoten und Appedix findet sich im PDF hier.
Einführung
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit (im Folgenden: GRÜZ) zwischen Deutschland und Frankreich hat im Zuge des Kampfes gegen die Covid-19-Pandemie an politischer und medialer Aufmerksamkeit gewonnen. Die Gesundheitszusammenarbeit ist dabei vor dem Hintergrund der Pandemie ein besonderer Indikator für Schwächen und Herausforderungen, aber auch für Chancen, die sich für die Zukunft eröffnen.
Der Satz „jede Krise ist immer auch eine Chance“ war während der Pandemie eine vielbeschworene Formel der deutsch-französischen GRÜZ. Auch der ehemalige deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwendete sie während seiner Anhörung vor den Mitgliedern der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung (DFPV) im Herbst 2020. Doch trotz diplomatischer Umschreibungen waren die Schwierigkeiten, die sich in der Gesundheitszusammenarbeit an der deutsch-französischen Grenze ergaben, deutlich aus den Ausführungen der Gesundheitsminister herauszuhören: Am Anfang der Pandemie, gab Spahn zu, habe es gedauert, „bis wir uns sortiert hatten“. In dieser ersten Phase des Krisenmanagements funktionierte wenig – ob in der bilateralen, grenzüberschreitenden oder in der europäischen Zusammenarbeit: Außengrenzen wurden einseitig und teilweise ohne ausreichende Vorwarnung der Partnerländer geschlossen und der Kampf gegen eine globale und grenzüberschreitende Pandemie war zunächst vor allem ein nationaler. Während sich die deutsch-französische Zusammenarbeit jedoch nach anfänglichen Schwierigkeiten sortierte, war die EU im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie vor allem in den ersten Wochen machtlos und weitestgehend abwesend.
Zu betonen gilt es in diesem Kontext, dass die EU aktuell kaum Kompetenzen in der Gesundheitspolitik hat, da diese nicht vergemeinschaftet ist. Dies könnte sich als Lehre aus der Pandemie ändern. Erste Akzente in diese Richtung hat etwa zuletzt die französische EU-Ratspräsidentschaft gesetzt, in deren Rahmen an verschiedenen Stellen die Ausweitung von EU-Kompetenzen im Gesundheitsbereich diskutiert wurde. Denn während die für die vorliegende Studie befragten Expertinnen und Experten ausnahmslos bestätigten, dass die EU insbesondere in der Anfangsphase des Kampfes gegen die Pandemie kaum ein Wort mitzureden hatte, bekräftigten sie umso mehr den Bedarf für gemeinsame, grenzüberschreitende Initiativen: nicht nur, aber auch in der deutsch-französischen Grenzregion und in verschiedensten Bereichen – vom Datenaustausch bis zur Mobilität des Gesundheitspersonals.
Gerade Regierungsvertreterinnen und -vertreter sowie Abgeordnete aus Deutschland und Frankreich haben eine aktivere Rolle für die EU mit Blick auf die gravierenden Mängel beim grenzüberschreitenden Krisenmanagement wiederholt angemahnt. Entsprechende Forderungen auf nationaler Ebene beziehen sich heute häufig auf Analysen aus den deutsch-französischen Grenzregionen, wo seit Jahren, teils Jahrzehnten, die Hindernisse beklagt werden, die trotz enger Zusammenarbeit in der Vergangenheit noch immer durch die Nähe einer nationalen Außengrenze für die Gesundheitsversorgung und -zusammenarbeit entstehen.
In ihrer Diagnose sind sich die Vertreterinnen und Vertreter der EU, der Regierungen und Parlamente Frankreichs und Deutschlands sowie der vielfältigen Institutionen in der deutsch-französischen Grenzregion einig: Die GRÜZ, ob bilateral oder europäisch, bedarf dringender Verbesserungen. Das genaue Vorgehen jedoch und die Fragen, in welcher Reihenfolge Hindernisse aus dem Weg geräumt, welche Kompetenzen neu verteilt und welche Ebenen wie eingebunden werden sollen, sind auch nach dem tiefgreifenden Einschnitt der Coronapandemie umstritten. Eine Entspannung der Lage ist für die Zukunft nicht zu erwarten. Deutschland und Frankreich haben zunehmend mit der Alterung der Gesellschaft und einem Fachkräftemangel zu kämpfen, der im Gesundheitsbereich besonders eklatant ist. Statt des nachbarschaftlichen Austauschs über Grenzen hinweg droht so eine Konkurrenzsituation zu entstehen: Nullsummen- statt Win-Win-Logik.
Der vorliegenden letzten Analyse der DGAP-Reihe zum Stand der GRÜZ zwischen Deutschland und Frankreich sollen diese Fragen als Rahmen dienen. Im ersten Kapitel der Studie werden ausführlich die grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit definiert, der aktuelle europäische und bilaterale rechtliche Rahmen erläutert und die vielfältigen Institutionen und Initiativen der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich vorgestellt, die bereits heute bestehen. Im folgenden zweiten Kapitel werden anhand konkreter Beispiele die strukturellen Unterschiede aufgezeigt, die trotz jahrzehntelanger enger Zusammenarbeit weiter bestehen. Das dritte Kapitel widmet sich zentralen Herausforderungen, die sich aus den Unterschieden zwischen dem deutschen und dem französischen Gesundheitssystem ergeben und die die grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit auch zukünftig beschäftigen werden. Abschließend wird im vierten Kapitel noch einmal die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Grenzregionen analysiert, bevor ein abschließendes Fazit gezogen wird.
Die vorliegende Publikation basiert auf einer Reihe von Hintergrundgespräche mit Expertinnen und Experten der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die zwischen September und Dezember 2021 geführt wurden. Die Inhalte der Gespräche sind in anonymisierter Form in die Studie eingeflossen. Eine Liste mit allen Gesprächspartnerinnen und -partnern findet sich am Ende der Publikation.
Grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit
Unter grenzüberschreitender Gesundheitszusammenarbeit wird im Rahmen der vorliegenden Studie die Kooperation zwischen zwei oder mehreren Staaten in Grenzgebieten zur gemeinsamen Lösung von Gesundheitsfragen verstanden. Unter Gesundheitsfragen werden dabei sowohl das Angebot als auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen zusammengefasst: Laut EU-Kommission zielt Gesundheitszusammenarbeit allgemein darauf ab, die „Mobilität von Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe, die in diesen Regionen leben und arbeiten, zu erleichtern, den Zugang zu lokaler Gesundheitsversorgung zu verbessern sowie gemeinsame Einrichtungen und Dienstleistungen zu entwickeln“.
Für die folgende Studie steht vor allem die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung im Fokus. Diese umfasst Leistungen, die in einem anderen als dem Versicherungsland erbracht beziehungsweise in Anspruch genommen werden. Auch im deutsch-französischen Kontext umfasst grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zunächst die Patientenmobilität, also die geplante oder ungeplante Behandlung von Patientinnen und Patienten außerhalb ihres Versicherungslandes. Der Begriff schließt aber auch die Mobilität von medizinischem Personal ein, etwa wenn Fachkräfte Leistungen im Ausland erbringen. Neben der Mobilität von Patientinnen und Patienten sowie Personal kann grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung schließlich auch die Kooperation zwischen Gesundheitsdienstleistern verschiedener Länder beinhalten, etwa in Form eines Austausches von Best Practices, gemeinsamen Weiterbildungsangeboten, Forschungskooperationen oder der gemeinsamen Nutzung spezieller Geräte und Technik (Shared Services).
|
Unter grenzüberschreitender Gesundheitszusammenarbeit wird die Kooperation zwischen zwei oder mehreren Staaten zur Lösung von Problematiken der Gesundheitspolitik in Grenzgebieten Trotz umfangreicher europäischer und binationaler Abkommen zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung ist innerhalb der EU die grenzüberschreitende Patientenmobilität gering. Rechtlich wird die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung auf EU-Ebene durch die Verordnung EG Nr. 883/2004 und die Richtlinie EU 2011/24/EU sowie auf deutsch-französischer Ebene durch das Rahmenabkommen von 2005 geregelt. Die politische Zusammenarbeit erfolgt über zahlreiche Gremien der deutsch-französischen GRÜZ. Der neugegründete Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ) muss derzeit noch seinen Platz im institutionellen Gefüge der deutsch-französischen GRÜZ finden. |
Oftmals zielt die Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Staaten bei grenzüberschreitender Gesundheitskooperation darauf ab, verschiedene nationale Gesundheitssysteme möglichst sinnvoll zu ergänzen. GRÜZ eröffnet für nationale Regierungen eine Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung in den eigenen Grenzregionen, die wegen ihres „peripheren“ Status und der geographischen Abgelegenheit häufig von medizinischer Unterversorgung bedroht sind, zu verbessern. Für Patientinnen und Patienten in den Grenzregionen ergibt sich im besten Fall eine (schnellere) Verfügbarkeit von medizinischen Leistungen, insbesondere bei komplizierten Behandlungen, die spezielle Infrastruktur voraussetzen. Ganz konkret können sich aus bi- oder multilateraler GRÜZ bei der Gesundheitsversorgung kürzere Wege ergeben, vor allem bei Notfällen, sowie zusätzliche Behandlungsangebote. Durch die grenzüberschreitende Kooperation zweier Dienstleister und den Aufbau einer gemeinsamen Einrichtung können darüber hinaus in manchen Fällen kostspielige Doppelstrukturen auf beiden Seiten der Grenze verhindert werden, im besten Fall sinken die Behandlungskosten. Andersherum bietet die Öffnung bestimmter Krankenhäuser für Patientinnen und Patienten aus dem Nachbarland zudem die Möglichkeit, diese höher auszulasten und somit die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderliche Mindestanzahl an Behandlungen sicherzustellen.
Trotz der aufgezeigten Vorteile einer engeren grenzüberschreitenden Gesundheitskooperation in bestimmten Kontexten ist die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in Europa und insbesondere die Patientenmobilität die Ausnahme. Nur 5% aller EU-Bürgerinnen und -Bürger haben laut einer Eurobarometer-Umfrage von 2015 grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch genommen: Bei der Mehrheit dieser Fälle wiederum, rund 60%, handelte es sich um ungeplante Behandlungen, beispielsweise einen Notfall während eines Auslandsaufenthalts oder eines Urlaubs. Nur 2% aller EU-Bürgerinnen und -Bürger haben eine geplante Behandlung im Ausland in Anspruch genommen. Die Zahl solcher Behandlungen bleibt seit Jahren stabil auf einem niedrigen Niveau.
| Seit 2013 gibt es dank eines Abkommens zwischen den Kliniken in Forbach (F) und Völklingen (D) eine enge grenzüberschreitende Partnerschaft im Bereich der Kardiologie. Das Abkommen, ursprünglich durch EU-Interreg-Mittel (Santranfor-Projekt) finanziert, erlaubt einerseits die Notfallversorgung französischer Patientinnen und Patienten im Herzzentrum der Klinik Völklingen. Andererseits übernehmen deutsche Ärztinnen/Ärzte regelmäßig Bereitschaftsdienste in der Klinik in Forbach, um auf französischer Seite Personalengpässe auszugleichen. Teil des Abkommens sind auch gemeinsame Fortbildungen und Hospitationen. Mehr als 300 deutsche und französische Patientinnen und Patienten haben von der grenzüberschreitenden Kooperation bereits profitiert. |
Der Großteil der grenzüberschreitenden Behandlungen erfolgt im ambulanten Bereich, nicht zuletzt, da stationäre Behandlungen im Ausland versicherungsrechtlich komplizierter ist. Eine Expertin für europäische Gesundheitspolitik schätzte im Hintergrundgespräch, dass europaweit rund 300.000 Behandlungen pro Jahr im Ausland durchgeführt und anschließend von den Versicherungen erstattet werden. Alle Daten zur grenzüberschreitenden Gesundheitskooperation müssen allerdings grundsätzlich mit Vorsicht betrachtet werden, da einige EU-Mitgliedstaaten schon seit Jahren keine Daten an die Kommission übermitteln.
Angelehnt an die eingangs zitierte Definition der EU-Kommission findet grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit in der EU derzeit also vor allem in Form von Kooperationen zwischen Gesundheitsdienstleistern und gegenseitigem Wissensaustausch statt. Konkrete Patientenmobilität über Grenzen hinweg, sprich zwischen einzelnen Mitgliedstaaten wie zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich, gibt es weiterhin nur wenig.
Neben dem schwachen politischen Willen und fehlenden versicherungsrechtlichen Rahmenabkommen spielt die Zurückhaltung der potenziellen Patientinnen und Patienten eine zentrale Rolle: Laut der Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2015 waren 46% der Befragten nicht bereit, medizinische Behandlungen im Ausland durchführen zu lassen. 16% der Befragten hätten eine Behandlung nur unter bestimmten Umständen in Erwägung gezogen. Der wichtigste Grund für diese Zurückhaltung war laut den Befragten die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung im eigenen Land. Außerdem wurden weite Wege für medizinische Behandlungen befürchtet und Ängste bezüglich möglicher Sprachbarrieren geäußert. Auch eventuelle Probleme bei der Kostenrückerstattung durch die Krankenversicherung spielten eine Rolle. Im deutsch-französischen Kontext wurde in mehreren Gesprächen auf das Ungleichgewicht bei den Behandlungen hingewiesen; wesentlich mehr Französinnen und Franzosen nehmen Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland in Anspruch als andersherum.
Die fehlende Datengrundlage auf EU-Ebene wird auch in Bezug auf die deutsch-französische Grenzregion deutlich. Viele Gesprächspartnerinnen und -partner bemängeln, dass keine präzisen Daten zum Umfang der Patientenströme vorlägen. Sicher ist nur, dass es mehr in Frankreich wohnhafte Patientinnen und Patienten gibt, die Gesundheitsleistungen in Deutschland in Anspruch nehmen, als andersrum. Allein bei der AOK Baden-Württemberg beispielsweise sind rund 30.000 französische Grenzgängerinnen und Grenzgänger versichert. Eine Beamtin erwähnte im Hintergrundgespräch, dass pro Jahr rund 10.000 in Frankreich Versicherte in Deutschland Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Daten zur Anzahl der in Deutschland Versicherten, die in Frankreich behandelt werden, gibt es jedoch nicht.
Rechtlicher Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit
Die Rolle der EU ist in Fragen der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit bisher sehr begrenzt. Die Kommission agiert vor allem als Vermittlerin zwischen den Mitgliedstaaten, fördert die Zusammenarbeit und drängt langfristig auf eine Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen Gesundheitssysteme. Dieses Engagement basiert auf Artikel 168 AEUV, der die Union verpflichtet, ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherstellen, die Patientenmobilität bestmöglich zu gewährleisten und die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten im Gesundheitsbereich zu fördern.
Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung rückte erstmals im Zuge der Einführung des Rechts auf Arbeitnehmerfreizügigkeit in den 1960er Jahren in den Fokus europäischer Zusammenarbeit. Mehrere Koordinierungsverordnungen zur Vereinfachung der Umsetzung der Freizügigkeit wurden erlassen. So wurde beispielsweise für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im EU-Ausland tätig werden wollten, die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Umständen und mit vorheriger Genehmigung der Krankenkasse, geplante medizinische Behandlungen im Ausland durchzuführen. In den folgenden Jahren wurde die Regelung zur verpflichtenden Vorabgenehmigung der Behandlungen im Ausland mehrmals vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angefochten. Im Rahmen der folgenden Urteile kam es zu einer progressiven Liberalisierung der Patientenmobilität innerhalb der EU:
„The legal basis of cross-border care, which had initially drawn only on the Treaty provisions for free movement of people, was progressively complemented by one based on the free movements of goods and services, on the reasoning that health care is an economic activity, irrespective of the type of care of health system, with prior authorization acting as hindrance to the principle of free movement.”
Heute stehen EU-Bürgerinnen und -Bürgern neben der Europäischen Krankenversicherungskarte für medizinische Notfälle im Ausland zwei parallele Verfahren für geplante medizinische Behandlungen in einem anderen EU-Staat als dem Versicherungsstaat zur Verfügung.
|
Definiert gemeinsam mit der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009, dass Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen grundsätzlich in dem Land versichert sein müssen, in dem sie arbeiten (unabhängig vom Wohnsitz). Für geplante Behandlungen im EU-Ausland ist für eine Kostenerstattung unter Umständen eine Vorabgenehmigung der Heimat-Krankenkasse notwendig. In diesem Fall werden die Kosten zunächst im Behandlungsland übernommen und dann im Nachhinein durch die Versicherung der/s Patientin/en erstattet. Dabei gelten die Erstattungssätze, die anfallen würden, wenn die/er Patient/in im Behandlungsland sozialversichert wäre. Seit 2006 gibt es zudem die Europäischen Krankenversicherungskarte, 2017 folgte das System zum elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) |
Mehrere Gesprächspartnerinnen und -partner betonten in den Hintergrundgesprächen, dass die EU-Richtlinie seit 2011 nur selten Anwendung gefunden hat. Die Pflicht für Versicherte, vor der Behandlung eine Vorabgenehmigung durch die Heimatkrankenkasse einzuholen, verkompliziert das Verfahren. Ein Interviewpartner vermutet dahinter die Absicht der Mitgliedstaaten, die Anwendung der Richtlinie zu begrenzen: „Beim Schreiben der Richtlinie wurden […] so viele Hürden eingebaut, dass es nicht verwunderlich ist, dass sie so selten angewendet wird“. Andere Rechtsgrundlagen der Patientenmobilität, die EU-Verordnung von 2004 zum Beispiel, aber auch binationale Vereinbarungen oder spezifische Abkommen einzelner Krankenkassen, seien klarer geregelt. Zudem bärgen sie weniger finanzielle Risiken für die Patienten, da keine Vorkasse nötig sei.
Eine Kennerin der EU-Initiativen zur Förderung der Gesundheitskooperation bestätigte mit Blick auf die Richtlinie den Verbesserungsbedarf. Im Jahr 2021 habe eine von der Kommission beauftragte Befragung zur Evaluierung der Richtlinie ergeben, dass viele Befragte die Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung als zentrales Hindernis kritisierten und sich mehrheitlich für deren Abschaffung ausgesprochen haben. Trotz der Kritik und der mangelnden Anwendung der Richtlinie scheinen unionsseitig bisher keine Änderungen am System der Vorabgenehmigungen geplant zu werden. Stattdessen fordert die Kommission die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu prüfen, ob „zehn Jahre nach Annahme der Richtlinie die Vorabgenehmigung für die Zwecke der Richtlinie weiterhin gerechtfertigt ist“ und fragt weiterhin an, ob die „Listen der einer Vorabgenehmigung unterliegenden Gesundheitsdienstleistungen gekürzt werden könnten“.
Neben europäischen Richtlinien und Verordnungen existieren vielfach bilaterale Abkommen. Deutschland und Frankreich beispielsweise haben 2005 ein Rahmenabkommen über die GRÜZ im Gesundheitsbereich abgeschlossen, das eine rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit schaffen soll. Die Zielvereinbarungen entsprechen den gängigen Zielen grenzüberschreitender Gesundheitskooperation, wie sie zu Beginn der Studie definiert wurden. Deutschland und Frankreich versprechen sich von dem Abkommen:
- einen besseren Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Grenzgebiets sicherzustellen,
- eine kontinuierliche Gesundheitsversorgung im Grenzgebiet zu garantieren,
- die schnellstmögliche notfallmedizinische Versorgung unabhängig von der Grenze zu gewährleisten,
- den Austausch des Gesundheitspersonals zu fördern sowie die Verteilung von Ressourcen zu optimieren.
Auf Grundlage des deutsch-französischen Rahmenabkommens von 2005 wurden seither mehrere bilaterale Kooperationsvereinbarungen zwischen regionalen Gebietskörperschaften oder lokalen Gesundheitsdienstleistern beschlossen: Zwei Vereinbarungen von 2009 regeln die GRÜZ im Bereich der Rettungsdienste, zwischen der damaligen französischen Region Elsass und Rheinland-Pfalz sowie zwischen dem Elsass und Baden-Württemberg. Im gleichen Jahr wurde eine Kooperationsvereinbarung für Schwerbrandverletzte zwischen mehreren lokalen Verwaltungsstrukturen geschlossen: der Agence régionale d’hospitalisation sowie der Union régionale des caisses d’assurance maladie auf französischer- und dem Schwerbrandverletztenzentrum der Unfallklinik Ludwigshafen auf deutscher Seite. Zuletzt folgte 2019 eine weitere lokale GRÜZ-Vereinbarung, diesmal bei der stationären Versorgung von Epilepsie-Patientinnen und -Patienten, zwischen der elsässischen Agence régionale de Santé (ARS), dem Universitätskrankenhaus in Straßburg und dem Epilepsiezentrum der Diakonie Kork.
Das institutionelle Gefüge der GRÜZ zwischen Deutschland und Frankreich
Verglichen mit anderen europäischen Grenzregionen ist die GRÜZ zwischen Deutschland und Frankreich überdurchschnittlich stark institutionalisiert. Im Laufe der Jahre haben sich entlang der Grenze ein dichtes Netzwerk und Foren auf verschiedenen Ebenen entwickelt. Ähnlich wie bei anderen Themen betonen viele Interviewpartner allerdings auch mit Blick auf die grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit, dass die Vielzahl an Organisationen die Sacharbeit teilweise verkompliziert. An einigen Stellen seien überflüssige Doppelstrukturen entstanden, die die Suche nach dem kompetenten Ansprechpartner eher verkomplizierten. Ein deutscher Gesprächspartner bringt es auf den Punkt: „Die verschiedenen Kooperationsformate […] könnten sich gut ergänzen, derzeit behindern sie sich aber eher gegenseitig“.
|
Um einen Eindruck dieses institutionellen Gefüges zu vermitteln, werden im folgenden Absatz die Institutionen der Gesundheitszusammenarbeit einer Region beispielhaft aufgeschlüsselt. Grundsätzlich gliedert sich die GRÜZ zwischen Deutschland und Frankreich in zwei große geografische Räume: Zum einen die Oberrheinregion entlang des südlichen Teils der Grenze zwischen beiden Ländern, mit Baden-Württemberg auf deutscher Seite, zum anderen die Großregion, mit den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz. Für erstere ist auf politischer Ebene vor allem die Oberrheinkonferenz (ORK) relevant, für letztere der Gipfel der Großregion. Innerhalb der politischen Gremien erfolgt die konkrete Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene in der Gesundheitskooperation in Gremien wie der Arbeitsgruppe (AG) „Gesundheitspolitik“ der ORK. Die AG wiederum setzt sich aus vier Expertenausschüssen zusammen, die sich regelmäßig zu Themen wie der Gesundheitsversorgung, der Prävention, der Gesundheitsförderung sowie der Gesundheitsbeobachtung in der deutsch-französischen Grenzregion austauschen. Die AG ist in der Oberrheinregion der zentrale Knotenpunkt der deutsch-französischen grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit.
Auf Initiative der AG wurde 2016 ein trinationales, deutsch-französisch-schweizerisches Kompetenzzentrum für GRÜZ im Gesundheitsbereich gegründet: TRISAN. Zentrale Aufgabe des Zentrums ist die Information von Patientinnen und Patienten sowie Beschäftigten im Gesundheitssektor zu grenzüberschreitenden Themen. Außerdem soll der Austausch und die Vernetzung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einerseits und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern andererseits im Gesundheitssektor auf beiden Seiten der Grenze gefördert sowie weitere Gesundheitskooperationsprojekte bei der Planung unterstützt werden. Aktuell koordiniert TRISAN ein durch EU-Mittel (INTERREG) finanziertes Projekt zum Aufbau eines trinationalen Handlungsrahmens für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung am Oberrhein.
Neben Kooperationsstrukturen wie der AG-Gesundheitspolitik und dem Kompetenzzentrum im Oberrheingebiet spielen auch die Eurodistrikte eine aktive Rolle in der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit. So hat in der Großregion der Eurodistrikt SaarMoselle 2019 eine Vereinbarung über eine engere Kooperation zwischen dem Département Moselle und dem Saarland im Gesundheitswesen unterzeichnet (MOSAR-Vereinbarung). Diese sieht vor, dass Bürger im Grenzgebiet auch ohne Vorabgenehmigung medizinischen Behandlungen erhalten können. Das Kooperationsabkommen setzt die Zielvereinbarungen des deutsch-französischen Rahmenabkommens von 2005 um, indem es regionale und lokale Verwaltungen verpflichtet, „die medizinische Zusammenarbeit zwischen den grenznahen Krankenhäusern, sowohl auf Ebene der Patientenmobilität als auch auf Ebene des Fachkräfteaustauschs, zu fördern“.
Aufbauend auf der MOSAR-Vereinbarung setzt der Eurodistrikt seit 2020 ein weiteres Projekt zur besseren Strukturierung der GRÜZ im Gesundheitsbereich um, die Gesundheitskooperation oder „GeKo“ SaarMoselle. Diese neue Initiative zielt darauf ab, nachhaltige finanzielle Strukturen zur Begleitung von Projektpartnerschaften zu schaffen, die Abhängigkeiten von INTERREG-Mitteln zu reduzieren und so erfolgreiche Projekte längerfristig erhalten zu können. Schon während der langwierigen Verhandlungen zur Willenserklärung im MOSAR-Abkommen wurde deutlich, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit neben Zeit auch viel Geld kostet, nicht zuletzt durch den Bedarf für eine regelmäßige Verdolmetschung der Sitzungen und der Arbeitsdokumente.
Neben der Vielzahl lokaler und regionaler Initiativen hat sich seit dem Rahmenabkommen von 2005 auch auf nationaler, bilateraler Ebene etwas getan. Mit der Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration (Vertrag von Aachen) zwischen Deutschland und Frankreich zu Beginn des Jahres 2019 wurde ein weiteres Forum für die bilaterale GRÜZ geschaffen: der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ). Ziel des AGZ ist es, „durch die Einbindung aller betroffenen Akteure über alle föderalen und administrativen Ebenen auf beiden Seiten der Grenze eine erhöhte Entscheidungsfähigkeit für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen“. In der Gesundheitszusammenarbeit verbindet sich mit der Schaffung des AGZ von Beginn an auch die Hoffnung, die verschiedenen Projekte entlang der deutsch-französischen Grenze endlich besser miteinander zu vernetzen und die spezifischen Kompetenzen, die an vielen Stellen entstanden sind, zu bündeln.
Das neue Gremium verfügt über ein ständiges Sekretariat in Kehl und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien und Parlamente in den Hauptstädten, regionaler Gebietskörperschaften, sowie aus verschiedenen grenzüberschreitenden Institutionen (etwa der Eurodistrikte) zusammen. In mindestens zwei Sitzungen pro Jahr, die sowohl auf Arbeitsebene als auch auf politischer Ebene stattfinden, werden Anliegen aus den Grenzregionen besprochen, aufbereitet und über die Sitzungen des Deutsch-Französischen Ministerrats (DFMR) an die Regierungen weitergeleitet. Das Thema Gesundheitszusammenarbeit war zwar ursprünglich nicht expliziter Teil des Arbeitsprogramms. Mehrere Gesprächspartner bestätigen aber, dass es, nicht zuletzt im Kontext der Coronapandemie, an Bedeutung gewonnen hat. Aktuell stehe das Thema „unter Beobachtung“, werde unter dem Titel „grenzüberschreitender Zugang zu Dienstleistungen“ teilweise aber schon in der Arbeit des AGZ berücksichtigt.
Wie in anderen Bereichen, wurde die Gründung des AGZ 2020 auch von den Verantwortlichen der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit grundsätzlich begrüßt, wie in vielen Hintergrundgesprächen deutlich wurde. Die meisten Gesprächspartner unterstreichen den Wert des zusätzlichen Gesprächskanals Richtung Hauptstädte, insbesondere mit Blick auf die frischen Erfahrungen aus dem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie. Gleichzeitig wurde häufig betont, dass der AGZ bisher vor allem ein politisches Forum war: Seine Gründung habe in der deutsch-französischen GRÜZ „die Karten neu verteilt“ und „die politische Dimension ins Spiel gebracht“, wie es eine Interviewpartnerin ausdrückt. Für die Gesundheitszusammenarbeit sei der Ausschuss deshalb zwar ein nützliches Instrument, um die nationale Ebene stärker einzubinden. Allerdings habe der AGZ bisher keine Antworten auf konkrete Probleme geben können, auch weil er lange „nur beschränkt handlungsfähig“ gewesen sei.
Als Gründe hierfür werden zum einen die Landtagswahlen in Baden-Württemberg (2021), Rheinland-Pfalz (2021) und im Saarland (2022) genannt, die die Handlungsspielräume des Gremiums stark einschränkt haben. Zum anderen war der Ausschuss lange kaum arbeitsfähig, das ständige Sekretariat war erst 2022 vollständig eingerichtet. Schließlich wurde wiederholt betont, dass der AGZ nun zunehmend als Konkurrenz zu bereits existierenden Formaten und Institutionen deutsch-französischer GRÜZ wahrgenommen werde. Es habe sich ein „gewisses Misstrauen“ in der Grenzregion etabliert. Auch in der Gesundheitszusammenarbeit am Oberrhein und in der Großregion sei der Eindruck entstanden, der AGZ wolle sich „des Themas bemächtigen“. Insbesondere in den in der Gesundheitszusammenarbeit sehr aktiven Gremien der ORK und den ihr unter- und beigeordneten Foren bestehe die Sorge, die eigene Sichtbarkeit in den Hauptstädten könne darunter leiden, „dass sich alles nur noch um den AGZ dreht“.
Für den AGZ ergibt sich daraus auch in der Gesundheitszusammenarbeit eine Zwickmühle. Angesichts der zuvor beschriebenen Vorbehalte bestehender regionaler Kooperationsformate steht der Ausschuss seit seiner Gründung konstant in einem Spannungsverhältnis: Einerseits besteht ein Rechtfertigungszwang gegenüber seinen nationalen Geldgebern. Andererseits wird in der Grenzregion viel Wert auf die Rückversicherung der neuen Institution gelegt, sich in der deutsch-französischen GRÜZ nicht vordrängeln zu wollen. Wenig überraschend wird in der Kommunikation des Ausschusses deshalb häufig auf das „Schlüsselkonzept Subsidiarität“ verwiesen und versichert, auf bereits bestehende Strukturen aufbauen zu wollen. Oft reichten interregionale Formate wie die ORK oder der Gipfel der Großregion, um Probleme anzugehen, heißt es auch aus dem AGZ. Der Ausschuss könne aber vermitteln, „sobald die nationalen Regierungen eingreifen müssen“. Der Vorteil des AGZ sei der direkte Draht nach Berlin und Paris und die politische Aufmerksamkeit, die etwa durch die Abgeordneten der nationalen Parlamente für grenzüberschreitende Themen geschaffen werden könne.
Neben dem AGZ hat der Aachener Vertrag noch ein zweites neues Instrument für die GRÜZ zwischen Deutschland und Frankreich geschaffen. Sogenannte „Experimentierklauseln“, also Ausnahmeregelungen von nationalem Recht, sollen es den Grenzregionen ermöglichen, mit speziell an ihre Bedürfnisse angepasste Regeln in einem „Reallabor“ zu experimentieren. Die Klauseln, die ursprünglich vor allem auf Wunsch der französischen Seite in den Vertragstext aufgenommen wurden, haben bisher aber noch keine Anwendung gefunden, werfen sie doch erhebliche Fragen auf – insbesondere in Frankreich. Laut französischer Verfassung müssen derartige Sonderregelungen nach einer Übergangsfrist entweder auf das gesamte Staatsgebiet übertragen oder wieder abgeschafft werden. Auf deutscher und französischer Seite scheint zudem ungeklärt, wer derartige Sonderregelungen einfordern kann.
Strukturelle Unterschiede in der deutsch-französischen Gesundheitszusammenarbeit
Verschiedenheit der Gesundheitssysteme
Wie in fast allen anderen Bereichen der deutsch-französischen Zusammenarbeit stehen auch in der Gesundheitszusammenarbeit die großen Unterschiede im Staatsaufbau und der Verwaltung schnellen Fortschritten an vielen Stellen im Weg. Die Gesundheitspolitik und ihre Deklinationen in der lokalen und regionalen Zusammenarbeit in den Grenzregionen sind ein anschauliches Beispiel – nicht nur für die weiterhin bestehenden Unterschiede, sondern insbesondere auch für die häufig damit einhergehende Unkenntnis der Verhältnisse im Partnerland sowie den Unwillen, sich mit den Unterschieden und daraus ergebenden strukturellen Problemen auseinanderzusetzen.
Die Gesundheitssysteme in Deutschland und Frankreich unterscheiden sich vor allem in zwei wichtigen Dimensionen. Gesprächspartner auf beiden Seiten der Grenze betonen immer wieder, dass das deutsche System deutlich marktwirtschaftlicher ausgerichtet sei als das französische. Während in Deutschland Gesundheitsdienstleister zum Wettbewerb angehalten werden, wird die Gesundheitsversorgung in Frankreich wesentlich stärker als grundlegende öffentliche Dienstleistung verstanden. Dieser Unterschied wird anhand der Organisationsstruktur der Krankenhäuser deutlich: Krankenhäuser auf der deutschen Seite verfügen über weitgehende Autonomie bei der Planung der von ihnen angebotenen Gesundheitsdienstleistungen, auf französischer Seite sind sie dagegen dem Schéma régional d’Organisation Sanitaire (SROS), einer durch die Verwaltung zentral organisierten Krankenhausplanung unterworfen. In Frankreich entscheiden nicht die Krankenhäuser, sondern die Beamten der Agences régionales de santé (ARS) über die genaue Ausgestaltung der angebotenen Gesundheitsdienstleistungen – bis in die Details bei Neuanschaffungen für eine Krankenhausausstattung.
|
Eine engere GRÜZ im Gesundheitsbereich wird durch die großen Unterschiede in den nationalen Gesundheitssystemen in Deutschland und Frankreich erschwert. Dies betrifft zunächst die Organisation und Struktur der Krankenhäuser, vor allem aber auch das System der Krankenkassen. Das Aufeinanderprallen einer zentralistisch gesteuerten Gesundheitspolitik in Frankreich und dem Föderalismus in Deutschland ist auch in der Gesundheitskooperation ein zentrales Hindernis für eine engere deutsch-französische GRÜZ. Die noch immer weit verbreitete Unkenntnis über das System des Nachbarlands macht kontinuierliche Lern- und Begleitprozesse bei grenzüberschreitenden Projekten unerlässlich. Auf französischer Seite wird insbesondere die unklare Kompetenzverteilung innerhalb des deutschen Ressortprinzips beklagt. Auf deutscher Seite wird vor allem die französische Tendenz zur Re-Zentralisierung der Gesundheitspolitik kritisiert. |
Darüber hinaus trifft die zentralistische Organisation des Gesundheitssystems durch den französischen Staat auch in der Gesundheitspolitik auf ein föderales deutsches System. Die großen Unterschiede zwischen beiden Ansätzen wurden nicht zuletzt im Zuge des Kampfes gegen die Ausbreitung des Coronavirus deutlich. Während in Deutschland die Bundesregierung und der Bundesminister für Gesundheit sich regelmäßig Auseinandersetzungen mit den Landesregierungen lieferten und verschiedene Bundesländer immer wieder von Empfehlungen aus Berlin abwichen, wurde der Kampf gegen die Pandemie in Frankreich gleich zu Beginn zur Chefsache erklärt. Dieser wurde vom Präsidenten und seinem Gesundheitsminister mithilfe des Conseil de Défense sanitaire, eines gesundheitspolitischen Ablegers des wöchentlich tagenden nationalen Sicherheitsrats (Conseil de défense et de sécurité nationale), zentral gesteuert. Für die GRÜZ in Gesundheitsfragen heißt das auch, dass die Bundesregierung wesentlich weniger konkrete Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten hat. Andererseits eilt den gesundheitspolitischen Entscheidungen aus Paris oft der Ruf voraus, zu wenig auf lokale Herausforderungen vor Ort einzugehen und insbesondere in den Grenzregionen die wahren Probleme zu verkennen.
Das Aufeinanderprallen eines zentralistischen Staates einerseits und eines föderalen andererseits zeigt sich auch in der Kooperation der Krankenkassensysteme, die in den Experteninterviews wiederholt als zentrale Herausforderung der GRÜZ im Gesundheitsbereich herausgestellt wurde. Auch hier stößt das zentralisierte französische System mit einer einzigen nationalen Krankenkasse, der Caisse d’assurance maladie, auf eine Vielzahl deutscher Kassen, die als privatwirtschaftliche Unternehmen weitgehend eigenständig agieren. Zu der großen Anzahl der Kassen kommt auf deutscher Seite noch die Unterscheidung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung hinzu. Bei Fragen zur Anwendung bestehenden Rechts, etwa der Frage, welches der im vorangehenden Kapitel beschriebenen Verfahren für eine Behandlung im Ausland genutzt werden soll, wünscht sich die französische Seite einen zentralen Ansprechpartner in Deutschland.
In Deutschland wird aber gerade die Vielfalt der Krankenkassen als Stärke empfunden. In vielen Hintergrundgesprächen wurde betont, dass die Diversität deutscher Krankenkassen nicht zwangsläufig ein Problem sei: Obwohl die Anzahl der Anbieter die Ausgestaltung einheitlicher Regeln erschwert und es für europäische Partner wie Frankreich schwieriger macht, mit deutschen Stellen zusammenzuarbeiten, ermöglicht die regionale Ausrichtung vieler deutscher Krankenkassen aufgrund der Präsenz vor Ort und Vertrautheit mit grenznahen Herausforderungen oft eine bessere Berücksichtigung spezifischer grenzüberschreitender Anliegen und Herausforderungen.
Kompetenzunterschiede auf der Entscheidungs- und operativen Ebene
Neben den Unterschieden in der Organisation der nationalen Gesundheitssysteme stellen auch die verschiedenen Zuständigkeiten der Verwaltungen ein großes Hindernis dar. Während in Frankreich, wie zuvor erwähnt, Gesundheitspolitik zentral von der Regierung in Paris gesteuert wird, sind in Deutschland vor allem die Bundesländer für die Ausgestaltung der Gesundheitspolitik vor Ort zuständig. Hier hat sich in der Coronapandemie eindrücklich gezeigt, wie schnell auf deutscher Seite auch im Angesicht einer eigentlich einheitlichen Herausforderung für das Bundesgebiet große regionale Unterschiede entstehen. Unterschiedliche Kompetenzverteilungen bremsen die Gesundheitszusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich regelmäßig aus. Französische Gesprächspartnerinnen und -partner wünschen sich eine stärkere Harmonisierung der deutschen Position, deutsche drängen auf größere Handlungsspielräume für ihre französischen Ansprechpartner in regionalen und lokalen Verwaltungen.
Obwohl die Kenntnis des Gegenübers im Zuge des Krisenmanagements in der Anfangsphase der Pandemie zweifellos zugenommen hat, bleibt sie häufig unvollständig und führt mindestens zu Unverständnis, schlimmstenfalls zu Misstrauen und Unmut. Aus den Interviews, die im Rahmen dieser Studie geführt wurden, ergibt sich das klare Bild, dass viele Verantwortliche der GRÜZ im Allgemeinen und der Gesundheitskooperation im Besonderen oft nicht wissen, welche konkreten Auswirkungen unterschiedliche Zuständigkeiten und Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit dem Partnerland haben können. An vielen Stellen ist deshalb bei grenzüberschreitenden Projekten weiterhin ein kontinuierlicher Lern- und Begleitprozess notwendig. In diesem Zusammenhang fordern Deutsche immer wieder, die Kompetenzverlagerung auf die regionale Ebene im Kontext der GRÜZ weiter fortzusetzen, um den Verantwortlichen, die bereits über spezifische Kenntnisse und Kontakte ins Nachbarland verfügen, mehr Entscheidungsspielräume zu ermöglichen.
Wie sehr die mangelnden Kenntnisse über das Nachbarland konkreten Fortschritten in der GRÜZ im Weg stehen können, zeigt sich anschaulich anhand eines Beispiels von Anfang 2021. Damals wandte sich die ARS Grand Est mit dem Vorschlag zu einer umfassenden Ergänzung des bereits erwähnten deutsch-französischen Rahmenabkommens von 2005 an die deutsche Seite. Der Inhalt des Vorschlags kann ausgeklammert werden, interessant ist die Kontaktaufnahme. Die französische Seite erhoffte sich im Kontext der Pandemiebekämpfung einen raschen Verhandlungsprozess und die zeitnahe Umsetzung, auch durch die Bundesregierung. Keines der beiden kontaktierten Bundesministerien, weder das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) noch das Auswärtige Amt (AA), verfügten jedoch über die Zuständigkeiten, um die Ergänzung des Abkommens zu verhandeln. Beide Ministerien verwiesen mehrfach auf die Zuständigkeiten der Länder. Damit steckte das Papier noch vor Beginn etwaiger Verhandlungen in einer Sackgasse. Die französische Seite zeigte sich in der Folge enttäuscht über die ausbleibende deutsche Reaktion. Auf deutscher Seite äußerte ein Gesprächspartner angesichts der Umstände der Kontaktaufnahme für das Konzeptpapier die Vermutung, die französische Seite habe das Papier absichtlich so übermittelt, „dass es von Deutschland nicht unterzeichnet werden kann“.
Die Anekdote steht beispielhaft für die Vielzahl an Problemen für die GRÜZ, die sich durch französischen Zentralismus und deutschen Föderalismus ergeben. Auf deutscher Seite wird der Föderalismus noch durch das Ressortprinzip der Bundes- und Landesregierungen verkompliziert. Während in Frankreich das Ministerium für Europa und Außenbeziehungen (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, MEAE) federführend für die GRÜZ zuständig ist, auch in Sachen Gesundheitszusammenarbeit, bindet das AA als federführendes Ministerium auf deutscher Seite das BMG als Fachministerium immer ein. Zusätzlich reden auf deutscher Seite, wie zuvor erwähnt, noch Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierungen mit. In der Gesundheitszusammenarbeit sind die genauen Kompetenzverteilungen und internen Konflikte, etwa zu den Zuständigkeiten bei grenzüberschreitender Gesundheitskooperation, von außen kaum nachvollziehbar. Unklare Kompetenzen und Streitigkeiten sind zwei Kritikpunkte, die von französischen Gesprächspartnerinnen und -partnern als größte Herausforderungen für die Zusammenarbeit mit deutschen Stellen genannt werden.
Doch auch auf deutscher Seite scheinen bei der GRÜZ in der Gesundheitszusammenarbeit die französischen Positionen nicht immer klar. Viele bedauern widersprüchliche Signale aus Paris, was die stärkere Einbindung grenznaher Verantwortlicher angeht. Tatsächlich drängen französische Regierungen bereits seit Jahren offiziell auf die Dezentralisierung des Staates. Erst im Februar 2022 wurde ein Gesetzespaket zur „Differenzierung, Dezentralisierung, Dekonzentration und Vereinfachung“ der Verwaltung im Parlament verabschiedet. Die offiziellen Verlautbarungen werden aber von den Realitäten französischer Gesundheitspolitik konterkariert; das bestätigen auch französische Expertinnen und Experten in mehreren Hintergrundgesprächen. Im Kontext der Coronapandemie hat in Frankreich zuletzt eine spürbare Re-Zentralisierung eingesetzt. Französische Regionen haben effektiv immer weniger Entscheidungsspielräume im Gesundheitsbereich. Im Kampf gegen die Pandemie wurden fast alle wichtigen Entscheidungen in Paris getroffen.
Für die deutsch-französische Gesundheitskooperation hat die Re-Zentralisierung in Frankreich unmittelbare Auswirkungen. So berichten Insider aus beiden Ländern, dass, trotz der kürzlich erfolgten französischen Initiative zur Neugestaltung des Rahmenabkommens von 2005, das Abkommen in Wahrheit immer weniger genutzt werde. Von deutscher Seite wird zudem der Vorwurf laut, Frankreich habe das Abkommen zuletzt nur noch sehr einseitig interpretiert und zöge grenzüberschreitende Lösungen für die französische Gesundheitspolitik erst in Betracht, wenn im nationalen Kontext ein Defizit bestehe. Die sich ergebenden Konflikte nehmen zu und wurden während der Pandemie überdeutlich. Ein deutscher Gesprächspartner berichtet, die im Rahmenabkommen „vertraglich vorgesehenen Synapsen“ seien in der Krisensituation schlicht „nicht vorhanden“ gewesen.
Neben der abnehmenden Nutzung des Rahmenabkommens und der Re-Zentralisierung der Zuständigkeiten in der französischen Gesundheitspolitik, kritisieren deutsche Expertinnen und Experten auch die Passivität vieler französischer Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort. Laut Rahmenabkommen ist die ARS dazu befähigt, deutsch-französische Vereinbarungen in der Grenzregion zu verhandeln. In der Realität, so kritisieren einige, hätten die Behörden zuletzt aber an vielen Stellen kaum reagiert – „bis an den Grad der Blockade“. Allgemein zeige die ARS kaum Interesse an einer Kooperation mit deutschen Partnerinnen und Partnern, hätte sich explizit gegen Sonderregelungen für Grenzregionen positioniert und bestünde auf Lösungen, die das gesamte Verwaltungsgebiet ihrer jeweiligen Region beträfen. Spiegelbildich zur bereits erwähnten französischen Kritik am deutschen Ressortprinzip bedauern einige zudem eine „nicht nachvollziehbaren Dominanz“ der ARS, deren Stellung von außen kaum zu verstehen sei. Die deutsche Seite hat sich der Situation angepasst und versuchte zuletzt zunehmend, die ARS und die regionale Ebene der französischen Verwaltung zu umgehen und stattdessen den direkten Kontakt zum Gesundheitsministerium in Paris zu suchen. Ein Vorgehen, das dem Geist des Rahmenabkommens von 2005 und der deutsch-französischen GRÜZ, wie sie im Kapitel 4 des Aachener Vertrags gefordert wird, klar zuwiderläuft.
Zentrale Herausforderungen der deutsch-französischen grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit
Fehlende Daten erschweren das Verständnis für Anliegen der GRÜZ in den Hauptstädten
Trotz der prominenten Positionierung der GRÜZ im Aachener Vertrag und der gestiegenen Aufmerksamkeit während der Coronapandemie haben viele Verantwortliche der deutsch-französischen grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit weiterhin den Eindruck, dass sich die Regierungen nur in begrenztem Maße für ihre Anliegen interessieren. Die Realität der Grenzregionen sei nur unzureichend bekannt und oft fehle der Wille, spezifische Probleme überhaupt nachzuvollziehen. Deshalb, so der Tenor in den meisten Hintergrundgesprächen auch für diese Studie, sei in den Hauptstädten und insbesondere in den Fachministerien noch viel Überzeugungsarbeit für GRÜZ zu leisten.
Häufig wird in den betroffenen Regionen beklagt, in Berlin und Paris herrsche ein verzerrtes Bild der Situation in den Grenzregionen vor. Ein Interviewpartner bemängelte zum Beispiel, dass es wenig Verständnis für Finanzierungsbedarf von zweisprachigen Gesundheitsangeboten gebe. In Berlin gehe man offenbar davon aus, „dass alle Menschen in der Grenzregion zweisprachig sind“. Dass die Lage in den Grenzregionen in den Hauptstädten teilweise verkannt wird, liegt vermutlich auch daran, dass es aktuell kaum belastbare Daten zu Grenzübertritten im Zusammenhang mit Gesundheitsleistungen gibt. Ebenso fehlt eine präzise Kartographie des bereits existierenden medizinischen Versorgungsangebotes auf beiden Seiten der Grenze. Entsprechend gibt es auch für die Zukunft kaum belastbare Modelle und Hochrechnungen zur künftigen Nachfrage nach grenzüberschreitenden Angeboten.
Die fehlende Datengrundlage macht es politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, Verwaltungen und Krankenkassen fast unmöglich, den genauen Bedarf an Beratungsangeboten, Einrichtungen und Kooperationsformaten zu identifizieren. Erschwerend kommt auch hinzu, dass die Daten, die es auf einer Seite der Grenze vielleicht gibt, oft nur schwer auf die andere Seite übertragen und mit dortigen Datensätzen verglichen werden können. Das führt dazu, dass „Pendler nach dem Grenzübertritt aus der Statistik verschwinden“, wie eine Gesprächspartnerin sagt.
Auch hier hat die Coronapandemie die Lücken in der Zusammenarbeit in aller Schärfe deutlich gemacht. Die Notwendigkeit der besseren Erfassung von Eckdaten der Gesundheitsversorgung, etwa bezüglich freier Intensivbetten in den Krankenhäusern in beiden Ländern, war auch in der überregionalen Medienberichterstattung ein großes Thema. Allerdings ist nicht nur die GRÜZ von fehlender oder lückenhafter Datenerhebung betroffen. Auch im nationalen Kontext ist das Problem seit langem bekannt und wird auf deutscher wie auf französischer Seite bestätigt. Eine Gesprächspartnerin berichtet, dass das BMG auch im nationalen Kontext keine präzisen Aussagen zu Intensivbetten in Deutschland machen konnte, „geschweige denn zu Frankreich“.
|
Unzureichende verlässliche Daten zur grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit und Patientenmobilität führen dazu, dass der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit in den Hauptstädten nur unzureichend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der starke wirtschaftliche Wettbewerb und die ökonomischen Zwänge der Gesundheitsversorgung, insbesondere in Deutschland, sind heute an vielen Stellen ein großes Hindernis für eine engere grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit. |
Auch auf europäischer Ebene ist die fehlende Datengrundlage ein Thema. Im Rahmen des Monitorings zur bereits diskutierten Richtlinie 2011/24/EU sieht die Kommission regelmäßige Erhebungen zur Nutzung grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleistungen in den Mitgliedstaaten vor. Allerdings stellen einige Staaten, unter anderem Deutschland, keine solchen Daten zur Verfügung. Die Behörden verweisen auf Nachfrage darauf, dass deutsche Krankenkassen bisher nicht gesetzlich dazu verpflichtet seien, entsprechende Daten zu übermitteln.
Um auf das Fehlen belastbarer Daten hinzuweisen und die Situation zumindest stellenweise zu verbessern, plant der AGZ derzeit mit Unterstützung des DFMR und einer EU-INTERREG-Finanzierung eine „grenzüberschreitenden Lebenslagenbefragung“. Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Bedarf, die in der Gesundheitspolitik wie auch in anderen Bereichen seit vielen Jahren angemeldet werden, statistisch zu untermauern.
Politische Willensbekundungen treffen auf wirtschaftliche Zwänge
Dort, wo fehlende Daten und mangelnde Kenntnisse des Partnerlands und seiner Verwaltung überwunden wurden, stellt sich häufig ein weiteres Problem: Die Gesundheitsversorgung ist insbesondere in Deutschland von wirtschaftlichem Wettbewerb und finanziellen Bedürfnissen und Zwängen bestimmt, die einer engeren grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit oft im Weg stehen. Vertreterinnen und Vertreter regionaler grenzüberschreitender Vereine, Organisationen und Initiativen beklagen regelmäßig die Diskrepanz zwischen politischen Willensbekundungen, Gipfelerklärungen und Verträgen, die eine engere grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit fordern und der Realität in den Grenzregionen, wo –auch nach dem Schock massiver Einschränkungen des Grenzverkehrs während der Pandemie – häufig kein Geld für spezifische Maßnahmen in den Grenzregionen vorhanden zu sein scheint.
Eine wirtschaftliche Win-Win-Situation ist an den meisten Stellen die Voraussetzung für Fortschritte in der deutsch-französischen GRÜZ, das wurde in vielen Hintergrundgesprächen deutlich. So kooperierten beispielsweise deutsche Krankenhäuser und französische Gemeinden in der Vergangenheit meist nur dann, wenn in der Folge dank steigender Patientenzahlen auf deutscher Seite mehr finanzielle Mittel durch die Krankenhäuser beantragt werden konnten. Unübersehbar stehen in beiden Ländern die Sozialsysteme unter großem Finanzierungsdruck. Der wirtschaftliche Nutzen, der durch zusätzliche Patientinnen und Patienten aus dem Nachbarland entstehen kann, ist ein entscheidender Faktor in vielen Kalkulationen.
Zwecks flächendeckender, guter Gesundheitsversorgung, wie sie sowohl von den nationalen als auch von den europäischen Gesetzgebern vorgesehen ist, gäbe es eigentlich ausreichend Potenzial für den Ausbau der deutsch-französischen GRÜZ in der Gesundheitspolitik. Trotz eines großen Ungleichgewichts im medizinischen Versorgungsangebot auf deutscher und französischer Seite der Grenze scheint es allerdings zunehmend schwierig, zu einer auch wirtschaftlich tragbaren Win-Win-Situation zu kommen. Von den bereits angesprochenen punktuellen Kooperationen abgesehen ist die bilaterale Zusammenarbeit auf beiden Seiten der Grenze häufig zuerst durch die Sorge vor wirtschaftlichen Nachteilen bestimmt. Während in den Verwaltungen deutscher Bundesländer und Krankenkassen lange befürchtet wurde, „dass französische Patienten deutsche Kliniken überrennen“, ist in Frankreich heute die Sorge groß, eigene Patientinnen und Patienten nach Deutschland zu verlieren. Dass eine ähnliche Situation an der französisch-belgischen Grenze bereits besteht, erleichtert die Situation nicht.
Die französischen Befürchtungen äußern sich nicht nur in der abnehmenden Bereitschaft für neue Kooperationsformate, sondern belasten auch bereits bestehende. Für französische Patientinnen und Patienten und insbesondere für ehemalige Grenzgängerinnen und Grenzgänger sei es, so stellte sich in verschiedenen Gesprächen heraus, in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden, die für Behandlungen im Ausland benötigten Formulare zu erhalten. Die französische Caisse d’assurance maladie habe zuletzt immer häufiger betont, dass die Gesundheitsversorgung in Frankreich ausreiche. Die Argumentation deutet schon darauf hin, dass das Thema politisch hochsensibel ist. Gerade für die französische Seite ist es im Kontext der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit schwierig, mit den Defiziten in der lokalen und regionalen Gesundheitsversorgung umzugehen, beziehungsweise „die nationale Unterversorgung im Grenzgebiet einzugestehen“, wie es ein Gesprächspartner ausdrückt. Unter dem Schlagwort der „Versorgungswüsten“ (déserts médicaux) wurde das Thema der aktuellen Regierung auch in den Wahlkämpfen der vergangenen Präsidentschafts- und Legislativwahlen vorgeworfen.
Grundsätzlich steht Frankreich mit der Befürchtung, eigene Patientinnen und Patienten ans Ausland zu verlieren, aber mitnichten allein da – darauf deuten die verhaltenen Fortschritte hin, die entsprechende Initiativen wie das European Reference Network System in den vergangenen Jahren gemacht haben.
Diese Sorge spiegelt sich auch in den Bemühungen zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität des Gesundheitspersonals in der Grenzregion wider. Der politische Wille, im eigenen Land ausgebildeten Fachkräften die Möglichkeit einer Tätigkeit im Ausland zu erleichtern, hat sich angesichts der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels auf beiden Seiten der Grenze zuletzt deutlich verringert. Mehr noch als mit Blick auf die Patientenmobilität stufen mehrere Interviewpartner das Thema der Mobilität des Gesundheitspersonals zwischen Deutschland und Frankreich als „politisches Tabu“ ein. Tatsächlich sind medizinische Fachkräfte, die grenzüberschreitend tätig werden wollen, mit vielen Hindernissen konfrontiert: angefangen bei der Anerkennung von Diplomen und Ausbildungen, bis hin zu Ausnahmeregelungen bei der Berufshaftpflichtversicherung und weiteren rechtlichen Vorgaben. Auf entsprechende Probleme wird ausführlich im zweiten Teil des Monitoring-Projekts zur GRÜZ eingegangen.
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich
Die deutsch-französisch Grenzregion wurden von den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie besonders hart getroffen. Einschränkung des Grenzverkehrs beispielsweise und Pflichttests für die Einreise von Berufspendlerinnen und -pendlern wirkten sich erwartungsgemäß überdurchschnittlich stark auf diese Regionen aus, obwohl die betroffenen Gebiete vom epidemischen Geschehen nicht zwangsläufig stärker betroffen waren als der Rest beider Länder. Vereinzelte Angriffe auf Pendlerinnen und Pendler im Frühjahr 2020 und das zwischenzeitliche Wiederaufleben vergessen geglaubter Ressentiments gegenüber den Nachbarn führte zu Spannungen, die in den Grenzgebieten weiterhin nachwirken. Eine Gesprächspartnerin sagt, während der Pandemie sei etwas „kaputt gemacht worden“ und müsse nun „langsam wieder aufgebaut werden.“
|
Während die Grenzregionen insgesamt stark von den Einschränkungen des Grenzverkehrs betroffen waren, trafen die Maßnahmen Beschäftigte im Gesundheitssektor besonders. Vor allem in den Krankenhäusern im Grenzgebiet sei man „überrascht und schockiert“ gewesen. Passend dazu wählt eine Gesprächspartnerin das sprachliche Bild einer „offenen Wunde“, die die Pandemie-Zeit in der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit hinterlassen habe. Auch im Gesundheitsbereich bestätigte sich zudem das Gefühl, in den Hauptstädten seien Maßnahmen beschlossen und Regeln erlassen worden, ohne die Auswirkungen auf das tägliche Leben in den Grenzregionen zu bedenken und Rücksicht zu nehmen, etwa auf Beschäftigte im grenzüberschreitenden Gesundheitssektor.
Gerade in der Gesundheitspolitik ist zudem auf französischer Seite die Wut über den deutschen Alleingang bei den Einschränkungen des Grenzverkehrs im März 2020 noch sehr präsent. Ein Gegenbeispiel, das meist in der Folge angeführt wird, ist die stark mediatisierte Aufnahme französischer Erkrankter in deutschen Kliniken. Laut einer Gesprächspartnerin wurden in dieser Zeit rund 120 Menschen von Frankreich nach Deutschland verlegt, teilweise in Kliniken weit weg von der Grenze. Angesichts der absoluten Fallzahlen sicher nur ein kleiner Bruchteil, der aber offensichtlich symbolisch großen Wert hatte und die Ressentiments und Vorfälle wenigstens zu einem gewissen Teil wieder entkräftete.
Trotz des Schocks, der Überraschung und der Versäumnisse sehen viele Verantwortliche der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit die ersten Monate der Coronapandemie im Rückblick auch als Chance. Die Erfahrungen aus dieser Zeit seien ein „wichtiger Treiber, um grenzüberschreitende Initiativen voranzubringen“. Im Verlauf der Pandemie sei auch in den Hauptstädten das Bewusstsein für die grenzüberschreitende Dimension von Gesundheitspolitik und Gesundheitsversorgung gestiegen. Die Hoffnung sei nun, dass auch die Sensibilität für die Notwendigkeit grenzüberschreitender Strukturen in Notsituationen insgesamt gesteigert wurde. Eine Interviewpartnerin mit langjähriger Erfahrung in der deutsch-französischen Gesundheitszusammenarbeit beschreibt zum Beispiel, dass die Vernetzung deutscher und französischer Rettungsleitstellen eine ganz neue Bedeutung bekommen habe. Nicht nur im Kontakt mit den Gesundheitsministerien und deren nachgeordneten Behörden, sondern auch in den Innenministertreffen habe man gespürt, dass das Grenzthema während der Pandemie verstärkt in den Fokus gerückt sei. Ein anderer Gesprächspartner begrüßt schlicht die Tatsache, dass er nun nicht mehr erklären müsse, „warum man grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit braucht“.
Ein weiterer positiver Effekt des akuten deutsch-französischen Krisenmanagements in der Pandemie-Zeit ist die bereits angedeutete Vertiefung der institutionellen Kenntnisse der Gegenseite. Nach einer anfänglichen Findungsphase, die von großer Unsicherheit und vielen Schwierigkeiten geprägt war und während der die grenzüberschreitende Kommunikation nur sehr bedingt funktionierte, etablierte sich schnell ein intensiver und regelmäßiger Austausch. Neben einer wöchentlichen Telefonschalte zwischen den verantwortlichen Behörden in Deutschland und Frankreich, an der teilweise bis 100 Vertreterinnen und Vertreter beider Länder sowie grenzüberschreitender Institutionen wie dem AGZ teilnahmen, haben sich zahlreiche weitere formelle und informelle Kanäle des gegenseitigen Austausches entwickelt, die es in der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit in diesem Maße und in dieser Intensität bisher nicht gab.
Vertreterinnen und Vertreter der Grenzregionen verfolgten in den Telefonschalten und anderen Formaten immer zwei Hauptziele: Berlin und Paris wurden über die Konsequenzen ihrer Entscheidungen für Grenzregionen informiert und insbesondere auf die Situation der Grenzgängerinnen und Grenzgänger aufmerksam gemacht. Diese kontinuierliche Informationsarbeit war an vielen Stellen von Erfolg gekrönt. Der AG-Gesundheitspolitik der ORK gelang es, flankiert durch lokale und nationale Abgeordnete, für die Einreise ins Nachbarland eine 24-Stunden-Ausnahmeregel für Pendlerinnen und Pendler zu erwirken und die Anerkennung französischer Testergebnisse an der deutschen Grenze durchzusetzen. Eine Beamtin beschreibt, der Druck aus den Grenzregionen sei auf der Arbeitsebene wenig spürbar gewesen, sondern habe vor allem auf der „politischen Ebene“ Wirkung gezeigt. Trotzdem hätten aber die Weisungen und Arbeitsaufträge nach und nach die politische Dringlichkeit der Anliegen widergespiegelt, etwa die „stetige Prüfung möglicher Entlastungen für Grenzgänger“, beispielsweise durch den Aufbau von zusätzlichen Testeinrichtungen an der Grenze.
Die spontanen Formate und Kontakte wurden aber nicht von allen Beteiligten und in allen Situationen als Bereicherung wahrgenommen. Als problematisch wurde zum Beispiel an vielen Stellen empfunden, dass Ad-hoc-Formate wie die Telefonschalten „oftmals zu Asymmetrien geführt haben“. Diese seien durch mangelnde Vorbereitungszeit und fehlende Kenntnis der Verwaltungsstrukturen der Gegenseite entstanden und hätten teilweise dazu geführt, dass sich ohnehin bestehende Spannungen während der Ad-hoc-Schalten „[…] teilweise noch verstärkt haben“. Eine deutsche Gesprächspartnerin berichtet, dass Vertreter der französischen Region Grand Est mehrmals „irgendwelche Ad-hoc-Konferenzen“ organisiert hätten, ohne vorher die zuständigen deutschen Stellen zu informieren und den Inhalt der Gespräche zu besprechen. Darüber hinaus sei der Ton in den bilateralen Austauschformaten „mitunter unangemessen geworden“. Dies sei besonders der Fall gewesen, sobald die Kritik lokaler Vertreterinnen und Vertreter ungefiltert an ihre Kolleginnen und Kollegen aus den nationalen Ministerien herangetragen worden sei.
Schließlich wird die Nachhaltigkeit der neu entstandenen Formate und Kontakte bezweifelt. GRÜZ sei während der Pandemie oft spontan und notgedrungen entstanden. Mehrere Gesprächspartnrinnen und -partnerr fürchten nun, dass die hohe Informations- und Kooperationsdichte nicht über die pandemische Ausnahmesituation hinaus erhalten werden könne. Die Hoffnungen auf große Fortschritte in der grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit seien mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie der Frustration gewichen. Spürbare Fortschritte seien bisher nicht eingetreten und man merke, wie „die Aufmerksamkeit, die während der Pandemie entstanden ist, wieder verschwindet“.
Die große Mehrheit der befragten Verantwortlichen der deutsch-französischen grenzüberschreitenden Gesundheitszusammenarbeit rechnet nicht damit, dass die nationale und europäische Gesundheitspolitik in Zukunft stärker auf grenzüberschreitende Kooperation ausgerichtet werden wird. Auf der Arbeitsebene werde zwar weitergearbeitet, von politischer Seite seien aber weder im bilateralen, deutsch-französischen noch im europäischen Kontext großen Impulse oder Veränderungen zu erwarten, „so lange nicht alle Mitgliedstaaten gleicherweise partizipieren und profitieren“.
Fazit
Die grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich war am unmittelbarsten von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen. Allerdings haben die Einschränkungen im Grenzverkehr und die Verzögerungen bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten aus dem Nachbarland bereits bestehende Probleme und Mängel eher verdeutlicht als dass sie neue geschaffen hätten.
Im Rahmen der Recherchen und Gespräche für die hier vorliegende dritte und letzte Studie des Monitoring-Projekts zur deutsch-französischen GRÜZ konnten einige grundlegende Beobachtungen aus der ersten und zweiten Studie der Serie wiederholt und bestätigt werden:
- Deutschland und Frankreich unterscheiden sich in Staatsaufbau, politischer Kultur und den Zuständigkeiten der Verwaltungen – auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene – noch immer derart voneinander, dass, statt auf eine baldige Angleichung zu setzen, massiv in die Kenntnis der Gegebenheiten im Partnerland (re)- investiert werden sollte.
- Im Kontext der Krisen- und Ausnahmesituation der Coronapandemie sind in beiden Ländern Verhaltensmuster deutlich geworden, die diese Unterschiede erneut deutlich gemacht haben.
- In Frankreich wird zwar seit Jahrzehnten die Dezentralisierung der Verwaltungszuständigkeiten angekündigt. Das monatelange Krisenmanagement und der Kampf gegen die Pandemie haben jedoch eher dazu geführt, dass nachgeordneten regionalen Behörden, auch in der Grenzregion, Kompetenzen wieder entzogen wurden und der Zentralstaat gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist.
- In Deutschland verhindert das privatwirtschaftlichere und wettbewerbsorientierte nationale Gesundheitssystem, dass die Politik im Namen der deutsch-französischen Zusammenarbeit eine engere Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung verordnet: Wo keine Nachfrage ist, wird auch kein Angebot geschaffen.
Die Studie macht deutlich, dass es dennoch beziehungsweise gerade deswegen in spezifischen regionalen Kontexten von Bedeutung ist, die Gesundheitszusammenarbeit weiter zu verstärken. Angesichts einer alternden Gesellschaft auf beiden Seiten der Grenzen und mit Blick auf die immer kostspieligeren Infrastrukturen für die Sicherstellung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung macht eine Kooperation an vielen Orten entlang der deutsch-französischen Grenze Sinn – das zeigen nicht zuletzt die vielen lokalen Initiativen zur Förderung der GRÜZ und die Kooperationsvereinbarungen, die auf Grundlage des deutsch-französischen Rahmenabkommens geschlossen wurden. Um diese ohnehin bestehende Dynamik zu erhalten, zu unterstützen und im besten Fall zu befördern, sollten politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in den nationalen Hauptstädten, in den Sitzen der Regionen und in den Landeshauptstädten eine Reihe von vergleichsweise kostengünstigen Initiativen ergreifen:
Grenzüberschreitende Daten: Bedarf ermitteln und für die Zukunft planen
Wo keine Fakten und Zahlen als Grundlage zur Verfügung stehen, besteht besonders unter Druck die Gefahr, unüberlegte Entscheidungen zu treffen, die womöglich kurzfristige Entlastung versprechen, langfristig jedoch mehr Schaden anrichten. Die zeitweilige massive Einschränkung des Grenzverkehrs zwischen Deutschland und Frankreich ist ein Beispiel dafür.
Ein weiteres Beispiel sind die fehlenden Daten zu Intensivbetten, die während der Pandemie sowohl im nationalen als auch im binationalen Kontext zu einer Chiffre für die mangelnden Informationen in der Krisensituation geworden sind. Dabei zeigen die Reaktionen auf den Austausch von Patientinnen und Patienten, der trotzdem stattfand– oft dank engagierter Initiativen einzelner Personen, – dass Gesundheitszusammenarbeit nicht nur medizinisch Sinn macht, sondern darüber hinaus auch für gelebte grenzüberschreitende europäische Solidarität steht. Hier müssen bereits laufende Initiativen und Pilotprojekte ausgebaut und gefördert werden. Ebenso gilt es zu überprüfen, ob die Planung in nationalen Kontexten nicht an einigen Stellen Vorteile übersieht und Fortschritte verhindert.
Den institutionellen Austausch über Ebenen hinweg fördern
– auch 60 Jahre nach der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags
Dass die Bundesrepublik Deutschland und die Frankreich seit bald 60 Jahren so eng zusammenarbeiten wie kaum zwei andere Länder in Europa, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich beide Systeme dabei nicht unbedingt angenähert haben. In den deutsch-französischen Beziehungen werden oft Wissen und Nähe vorausgesetzt, die in der Realität nicht existieren. Trotz der gemeinsam beförderten europäischen Integration zeigt sich am Beispiel der Gesundheitsversorgung und insbesondere in den Grenzregionen, dass historische Unterschiede auch weiterhin tief in den nationalen Systemen verankert sind. Daran wird sich in naher Zukunft sehr wahrscheinlich nichts ändern. Kurzfristig selbst dann nicht, wenn die EU tatsächlich mehr Kompetenzen in der Gesundheitspolitik erhalten sollte.
Dies ist ein Grund mehr, bestehende Unterschiede so zu erklären, dass pragmatische Lösungen dort möglich sind, wo der Wille zur Zusammenarbeit schon heute besteht, statt auf mögliche Angleichungen in der Zukunft zu warten. Auch hier haben die Erfahrungen während der Pandemie gezeigt, dass schon der informelle Austausch im Rahmen regelmäßig stattfindender Telefonkonferenzen über mehrere Wochen hinweg große Fortschritte im Verständnis des Partnerlandes und seiner Verwaltung zeitigen kann.
Aus der Ausnahmesituation der Pandemie lernen: negative Erfahrungen verarbeiten und positive verstetigen
Dass in einem offenen Austausch auch Unterschiede deutlich werden und Konflikte entstehen, ist nicht zu vermeiden. Bei der Beobachtung der GRÜZ zwischen Deutschland und Frankreich wurde jedoch – themenübergreifend und in allen drei Studien – deutlich, dass Unterschiede zu selten konstruktiv betrachtet werden und Konflikte häufig nicht genutzt werden, um die Zusammenarbeit für die Zukunft zu stärken. Obwohl der „Resilienz“-Begriff seit Beginn der Pandemie in aller Munde ist, drohen viele Erfahrungen des Krisenmanagements ungenutzt in Vergessenheit zu geraten.
Öffentlich angesprochene Diskrepanzen mit dem Partnerland sind gerade in den Grenzregionen wichtig. Unverständnis gegenüber den Ansprechpartnerinnen und -partnern in den Verwaltungen sollte nicht als Schlusspunkt akzeptiert werden, sondern Ausgangspunkt für eine Annäherung sein. Debattiert werden sollte in allen Themenbereichen – ob im Hinblick auf Mobilität, den Arbeitsmarkt oder die Gesundheitspolitik – besser vor und nicht während der nächsten Krisensituation.