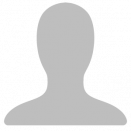Welche Auswirkungen hat die Flüchtlingskrise auf den Integrationsprozess und die innere Verfasstheit und Solidarität der EU?
Julian Rappold: Die Flüchtlingskrise offenbart und verstärkt die bereits in der Eurokrise sichtbar gewordenen Gräben zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Die Entscheidung der EU-Innenminister, auf dem Rat für Justiz und Inneres Ende September die Umverteilung von 120 000 Flüchtlingen innerhalb der Union auch gegen den Willen der Slowakei, Rumäniens, Tschechiens und Ungarns mit qualifizierter Mehrheit durchzusetzen, ist an sich zwar noch nicht besorgniserregend. Schließlich sind Mehrheitsentscheidungen ein notwendiges und bereits erprobtes Instrument, um die Handlungsfähigkeit einer auf 28 Staaten angewachsenen Union zu sichern. Viel schwerer wiegt die teils polemische und unnachgiebige Art und Weise, wie die EU-Staaten in einer so dringlichen Frage an ihren nationalen Positionen festhalten, teilweise identitätspolitisch argumentieren, sich gegenseitig die Schuld zuweisen und so eine gemeinsame europäische Lösung blockieren.
Gereon Schuch: In den eben angesprochenen osteuropäischen Mitgliedstaaten bestärkt diese Mehrheitsentscheidung gerade die Kritiker des europäischen Integrationsprozesses. Was bei uns als notwendiges und gerechtfertigtes Mehrheitsvotum dargestellt wird, nährt dort das Gefühl, nicht auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. In diesen Ländern wächst der Eindruck, Deutschland wende sich davon ab, die Interessen der kleineren Staaten zu beachten. Die später erfolgte Einführung von Grenzkontrollen durch Deutschland wurde als Druckmittel verstanden, da die Schengen-Freiheiten in Mitteleuropa von hohem symbolischem Wert sind.
Julian Rappold: Vor diesem Hintergrund ist europäische Solidarität zum Reizwort geworden: In der Flüchtlingskrise fordern sie zwar alle Mitgliedstaaten ein, aber interpretieren sie komplett unterschiedlich. Dies führt dazu, dass sich nach der Eurokrise nun weitere Risse im Zusammenhalt der EU auftun. Das Verhältnis zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten droht, sich nachhaltig einzutrüben, mit negativen Auswirkungen auf den Integrationsprozess. Schon jetzt profitieren rechtspopulistische Parteien von der Flüchtlingskrise und der Uneinigkeit der europäischen Mitgliedstaaten. Dies zeigen etwa die jüngsten Wahlerfolge der Dänischen Volkspartei und der Schwedendemokraten. Sollte es der EU nicht gelingen, eine umfassende, adäquate und vor allem rasche europäische Antwort zu präsentieren, werden die ohnehin schon durch die Eurokrise gewachsenen Zweifel der europäischen Bürger am Integrationsprojekt weiter wachsen. Auch für die weltweite Außenwahrnehmung der EU könnte dies negative Auswirkungen haben: Wenn sich die inneren Teilungen in der Flüchtlingskrise vertiefen, leidet die europäische Glaubwürdigkeit.
Was ist die Perspektive der ost- und mitteleuropäischen Staaten?
Stefan Meister: Ähnlich wie die ostdeutsche Gesellschaft sind die Ostmitteleuropäer bisher wenig in Kontakt mit Ausländern gekommen und haben sich über Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft wenig in Toleranz üben können. Damit verbunden sind oftmals eine schwache Zivilgesellschaft und eine Unterentwicklung des öffentlichen und politischen Raumes. Gleichzeitig handelt es sich in den meisten Fällen um relativ homogene Gesellschaften, die wie in Tschechien eher atheistisch geprägt sind oder wie in Polen katholisch und wertkonservativ. Das alles führt zu Abwehrreflexen, wenn es um die Verteilung von Flüchtlingen geht, die dann auch noch auf Initiative Deutschlands erfolgen soll, dem Land, das die Entscheidungen in der EU immer stärker dominiert und damit auch in den ostmitteleuropäischen Staaten ein gewisses Unwohlsein mit sich zieht.
Gereon Schuch: Nun ja, so homogen sind die entsprechenden Gesellschaften nicht. In Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien gibt es erhebliche Probleme bei der Integration der eigenen Roma-Minderheiten. Flüchtlinge und Roma sollen keinesfalls gleichgesetzt werden, aber nicht funktionierende Integration und deren Folgen sind dort nahezu jedermann bekannt. Teile der Gesellschaften haben Vorbehalte und Integrationsängste - das mag man für gerechtfertigt halten, oder nicht. Aber man sollte es nicht ignorieren, sondern überlegen, wie man dem klug begegnen kann.
Stefan Meister: In Polen hat inzwischen die Flüchtlingsdebatte den Themenkomplex Ukraine-Russland-Krise in ihrer Bedeutung überholt und ist Teil des Parlamentswahlkampfes geworden, in dem sich populistische Parteien mit diesem Thema profilieren. Jedoch sollten die Ängste in den ostmitteleuropäischen Gesellschaften nicht unterschätzt werden, da sie real erscheinen und erst aus der positiven Erfahrung heraus abgebaut werden können. Dies könnte sonst zu einem stärkeren Abwehrreflex gegenüber der deutschen und der EU-Hegemonie werden. Gleichzeitig gilt: Wer Solidarität in der Sicherheitspolitik einfordert, sollte auch Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen zeigen.
Weshalb kam es zu Spannungen zwischen den Regierungen in Berlin und Budapest?
Gereon Schuch: Die südliche Landesgrenze Ungarns ist gleichzeitig eine EU-Außengrenze und darüber hinaus Grenze des Schengen-Raums. Die ungarische Regierung sieht sich deshalb in der Pflicht, diese Grenze zu kontrollieren und zu schützen. Um einen massenhaften unkontrollierten Übertritt dieser bislang ungesicherten, grünen Grenze zu Serbien kanalisieren zu können, ließ die Regierung einen Grenzzaun errichten, der einen Grenzübertritt nur noch an kontrollierten Übergängen ermöglicht. Derartige Grenzsicherungen sind keinesfalls einzigartig, man blicke nur nach Spanien oder Bulgarien. Gemäß der Dublin-III-Verordnung müsste Ungarn die ins Land kommenden Flüchtlinge registrieren; diese wollten jedoch überwiegend nach Deutschland weiterreisen und verweigerten teilweise die Registrierung. Die ungarischen Behörden waren mit der großen Zahl an Flüchtlingen, die bis zur Fertigstellung des Zaunes ins Land kamen, überfordert und konnten anfangs keine angemessene Versorgung gewährleisten. Ausländische Kritik einer unwürdigen Behandlung der Flüchtlinge wurde empört zurückgewiesen. Mit Unverständnis wurde in Budapest aufgenommen, dass einerseits die Sicherung der EU-Außengrenze verlangt, andererseits jedoch die Errichtung des Grenzzaunes kritisiert wurde.
Das Ungarn gegenüber vorgebrachte Argument, mit Zäunen lasse sich das Flüchtlingsproblem nicht lösen, ging an der Sache vorbei, da Budapest mit seinem Verfahren darauf abzielte, den Grenzübertritt kontrollieren und die vorgeschriebene Erfassung durchführen zu können. Nachdem Deutschland signalisiert hatte, Flüchtlinge nicht mehr zurück zu schicken und damit faktisch die Regelungen der Dublin-Verordnung aushebelte, zogen die in Ungarn befindlichen und weiterhin ins Land kommenden Menschen massenhaft aus den Notunterkünften weiter nach Deutschland – die medienwirksamen Bilder jener Tage sind uns in Erinnerung. In der Dynamik dieser Entwicklung kam es zu Abstimmungsdefiziten zwischen ungarischen, österreichischen und deutschen Stellen und daraus resultierenden Vorwürfen.
Aus der deutschen Perspektive blieb die ungarische innenpolitische Dimension oft im Unklaren: Große Teile der ungarischen Bevölkerung lehnen eine liberale Flüchtlingspolitik und die großzügige Aufnahme von Migranten ab. Ministerpräsident Orbán, der eine verbindliche EU-Quote zur Aufteilung der Asylbewerber nicht akzeptiert, artikuliert damit durchaus die Mehrheitsmeinung im Land. Die rechtsextreme, im Parlament vertretene Partei Jobbik vertritt eine strikt gegen Migranten gerichtete Politik und setzt damit Orbán innenpolitisch unter Druck. Manche Äußerungen und Aktionen, wie etwa eine landesweite Plakat-Aktion, in der Asylbewerbern – in ungarischer Sprache – bedeuted wurde, nicht ins Land zu kommen, sind vor diesem Hintergrund zu betrachten. Mittlerweile verfährt Ungarn wie manch andere EU-Länder, und lässt Migranten ohne Registrierung nach Deutschland weiter ziehen.
Wie nehmen andere EU-Mitgliedstaaten Deutschlands Verhalten in der Flüchtlingskrise wahr?
Julie Hamann: Verständnis für ihren Kurs in der Flüchtlingskrise findet Angela Merkel derzeit wenig in Europas Hauptstädten. In Paris herrschen Zweifel, wenn nicht gar Unverständnis gegenüber ihrem Ansatz. Zwar unterstreicht François Hollande regelmäßig die Notwendigkeit einer europäischen Lösung und signalisierte unter anderem während des symbolträchtigen gemeinsamen Auftritts vor dem Europäischen Parlament am 7. Oktober Unterstützung für die deutsche Kanzlerin. Auch machte er durch die Zustimmung zu einer Quotenregelung – der sich Frankreich, wie auch Deutschland, lange widersetzte – Zugeständnisse und kündigte die Aufnahme von 30 000 syrischen Flüchtlingen bis Ende 2016 an. Innenpolitisch sieht er sich aber mit dem Widerstand der konservativen Republikaner und der wachsenden Unterstützung für den rechtspopulistischen Front National konfrontiert – eine Konstellation, die insbesondere im Vorfeld der Regionalwahlen im Dezember von Bedeutung ist.
Auch in London, wo eine unterschiedliche Position in der Migrationspolitik nicht überraschend ist, hält man sich mit Kritik nicht zurück: Deutschlands Reaktion habe als „Pull-Faktor“ die große Anzahl an Flüchtlingen erst angezogen und die tatsächliche Krise mit ausgelöst. Zum offiziellen Start der Kampagnen über das britische Votum zum Verbleib in der Europäischen Union nutzen Politiker verschiedener Parteien das britische „opt-out“ aus dem Schengen-Abkommen und einer möglichen Quotenregelung, um für ein Vereinigtes Königreich außerhalb der EU zu werben.
Julian Rappold: An dieser teilweise harschen Kritik zeigt sich, dass der Einfluss der Bundesregierung auf andere europäische Hauptstädte in der Flüchtlingskrise trotz Solidaritätsforderungen und Drohungen begrenzt ist. Denn anders als in der Eurokrise, in der Berlin eine Führungsrolle innerhalb der EU eingenommen hat, ist es angesichts der immer stärker werdenden Flüchtlingsbewegungen von seinen europäischen Partnern abhängig. Die Bundesregierung sollte deshalb insbesondere die mittel- und osteuropäischen Staaten rasch wieder einbinden und diese auch mit Hilfe von Anreizen zur Kooperation bewegen. Nur mit einer breiten Unterstützung der Mitgliedsländer kann es auf europäischer Ebene eine umfassende Lösung geben, etwa hinsichtlich des Schutzes der europäischen Außengrenzen oder einer umfassenderen Quotenregelung. Resultate auf europäischer Ebene würden es der Bundeskanzlerin dann auch erlauben, dem wachsenden Unmut in der eigenen Bevölkerung und innerhalb der eigenen Partei entgegenzutreten.
Die Zahl der Asylbewerber vom Westbalkan sinkt; liegt das auch an Aufklärungskampagnen über die geringe Chance, in Deutschland Asyl bewilligt zu bekommen?
Sarah Wohlfeld: Die sinkenden Zahlen der Asylbewerber aus dem Westbalkan lassen sich auf verschiedene Ursachen zurückführen: Neben den medialen Aufklärungskampagnen seitens der Bundesregierung und Apellen nationaler Politiker an die eigene Bevölkerung sind es vor allem die Berichte abgelehnter und abgeschobener Asylbewerber, die abschrecken. Durch Mundpropaganda und in den sozialen Netzwerken machen Informationen über die schlechten Chancen, in Deutschland Asyl gewährt zu bekommen, schnell die Runde. Diese informelle Art der Informationsweitergabe ist wirksamer als jede von oben gesteuerte Kampagne.
Gleichzeitig muss man sich darüber bewusst sein, dass durch Abschreckung oder auch die Ausweitung des Prinzips der sicheren Herkunftsländer die Migration vom Westbalkan nicht gestoppt werden kann, solange die Fluchtursachen nicht bekämpft werden. Diese liegen zum einen, wie etwa im Fall der Roma, in massiv erlebter Diskriminierung und Armut. Ein anderer Teil der Menschen macht sich auf den Weg, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dass die nationalen von Korruption und Klientelismus geprägten Systeme nicht bieten können. Nach Jahrzehnten der Stagnation verlieren die Menschen die Hoffnung auf einen nachhaltigen Wandel. Alle eint dabei der Wunsch nach Perspektiven und einer besseren Zukunft. So lange diese bessere Zukunft in den Heimatländern nicht greifbar ist, werden die Menschen auswandern – so klein die Chance auf Asyl in der EU auch sein mag.
Destabilisiert die Flüchtlingskrise den Westbalkan?
Sarah Wohlfeld: In der Flüchtlingskrise hat sich gezeigt, wie schnell zwischenstaatliche Konflikte in der generell von bilateralen Streitigkeiten geprägten Region aufflammen können. Nach der zeitweisen Schließung der Grenze zu Serbien durch die kroatische Regierung, die von den Flüchtlingsströmen überfordert war, folgte ein polemischer – teilweise medial ausgetragener – Schlagabtausch zwischen den beiden Ländern, auch mit rhetorischen Bezügen zum Zweiten Weltkrieg. Dass diese Wortgefechte nicht weiter ausuferten, lag zum einen an der Intervention der EU – Kroatien öffnete in der Folge wieder seine Grenze – und zum anderen an der engen wirtschaftlichen Verflechtung beider Staaten. Dennoch wird deutlich, dass der Frieden in der Region nach wie vor fragil ist und durch externe Herausforderungen auf die Probe gestellt wird. Von daher ist es auch wichtig zu verhindern, dass bei einer weiteren Abschottung der Schengen-Außengrenzen ein Großteil der Flüchtlinge in den wirtschaftlich schwachen Balkanstaaten strandet. Die Regierungen wären in dem Fall mit der Versorgung der Menschen heillos überfordert, was weiteren zwischenstaatlichen als auch innerstaatlichen Zündstoff mit sich brächte. Die EU muss die Westbalkanstaaten in den Verhandlungen über eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise mit einbeziehen.
Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Gefahren anhaltender Migrationsbewegungen der eigenen Bürger, legal oder illegal, für die langfristige Entwicklung der Westbalkanstaaten. Es sind gerade auch Fachkräfte und Akademiker, die in der EU eine bessere Zukunft suchen – und den Heimatländern bei der Transformation der eigenen Gesellschaft fehlen. Diesem Braindrain muss entgegengewirkt werden, indem, nach Qualifizierung etwa in Deutschland, Anreize zur Rückkehr geschaffen werden. Auch hier ist entscheidend, dass die Menschen in ihren Heimatländern im Westbalkan eine Zukunftsperspektive sehen.
Julie Hamann ist Mitarbeiterin des Programms Frankreich/deutsch-französische Beziehungen der DGAP.
Dr. Stefan Meister ist Leiter des Programms Osteuropa, Russland und Zentralasien des Robert Bosch-Zentrums der DGAP.
Julian Rappold ist Programmmitarbeiter und kommissarischer Leiter des Alfred von Oppenheim-Zentrums für Europäische Zukunftsfragen der DGAP.
Dr. Gereon Schuch ist Stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts und Leiter des Robert Bosch-Zentrums für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien der DGAP.
Sarah Wohlfeld ist Programmmitarbeiterin des Alfred von Oppenheim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen der DGAP.