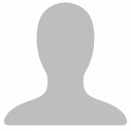Herr Sandschneider, Herr Schulz, warum hat die EU in der Ukraine-Krise versagt?
Sandschneider: Schimpfen wir nicht gleich zu Beginn auf Europa! So erfolglos war die EU nicht: In Kiew konnten drei Außenminister im Namen der EU die Gewalt auf den Straßen stoppen. Es konnte niemand wissen, dass Präsident Viktor Janukowitsch am Tag darauf dennoch stürzt.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier spricht von der "schärfsten Krise seit dem Mauerfall". Was kann die EU tun, um einen Krieg zu verhindern?
Schulz: Sie kann dafür sorgen, dass nicht geschossen wird. Sie muss die Gesprächskanäle zwischen Ukrainern, Russen und Europa offen halten. Menschen, die miteinander reden, schießen nicht aufeinander. Wenn sie aber einmal mit dem Schießen angefangen haben, werden weitere Schüsse folgen. Das nennt sich dann irgendwann Krieg.
Kann man mit Putin reden - oder sollte man den russischen Präsidenten mit Sanktionen in die Knie zwingen?
Schulz: Natürlich sagt unser Bauchgefühl: Mein Gott, da gehen Truppen aufeinander los, da können wir doch nicht vom Dialog reden! Aber das ist nüchtern betrachtet unsere einzige Chance, die Lage zu entschärfen. Wladimir Putin ist äußerst machtbewusst, der lässt sich mit Sanktionen nicht an den Verhandlungstisch zwingen. Aber er ist auch Pragmatiker: Wir müssen ausloten, ob er zu einer dauerhaften Lösung bereit ist - und wenn ja, zu welchem Preis.
Wird die Krim der Preis sein, den die Ukraine für den EU-Kurs bezahlen muss?
Sandschneider: Das wissen wir noch nicht. Mein Eindruck ist, dass Putin Machtpolitik des 19. Jahrhunderts betreibt, indem er auf der Krim erst einmal Fakten schafft. Doch Sanktionen sind immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit. In Syrien haben sie nichts bewirkt, und gegen Russland wäre das auch so. Die Zeiten sind vorbei, dass wir als Westen immer im Cockpit sitzen und den Rest der Welt mit Sanktionen dazu bringen zu tun, was wir für richtig halten.
Was hat die EU in Kiew falsch gemacht?
Schulz: Die Ukraine war faktisch pleite, als die Regierung unter Janukowitsch das EU-Assoziierungsabkommen unterschreiben sollte. Auf dem Gipfel in Vilnius haben wir ein bisschen Geld geboten, vor allem aber an den IWF verwiesen. Dabei hat das Land 15 bis 25 Milliarden Euro sofort gebraucht, um durch die Krise zu kommen. Wer hätte dieses Geld kurzfristig aufbringen sollen?
Also kann sich die EU ihre eigene Nachbarschaftspolitik nicht leisten?
Schulz: Wenn wir Außen- und Sicherheitspolitik effizient betreiben wollen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Geld kostet. Andere Regionen dieser Welt machen das so, Russland zum Beispiel. Die EU ist im Moment so sehr mit sich und ihren inneren Krisen beschäftigt, dass sie das nicht hinbekommt.
Ist es ein Fehler, dass die EU ihren Werteraum bis an die russische Grenze ausdehnen will?
Schulz: Es ist kein Fehler, wenn wir die Prinzipien unserer wertorientierten Gemeinschaft auf andere übertragen. Die individuellen Werte, die Rechte und Freiheiten der Menschen, die Stärke des Rechts anstelle des Rechts des Stärkeren - das ist ein Angebot, kein europäischer Werte-Imperialismus. Es obliegt dem Selbstbestimmungsrecht von Ländern wie der Ukraine, zu entscheiden, ob sie solch ein Angebot annehmen und die Werte übernehmen.
Sandschneider: Das klingt nett. Aber die EU bietet das nicht an. Sie verwendet es als Junktim, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Man denke nur an die Wirtschafts- und Handelspolitik gegenüber afrikanischen Staaten, die ständig mit Good-Governance-Klauseln belegt wird. Diese Politik ist in Anbetracht der Tatsache, dass China auf solche politischen Vorgaben verzichtet, längst gescheitert. Wir wissen als Europäer gut Bescheid über unsere Werte und unsere eigenen Moralvorstellungen. Aber wir wissen zu wenig über die Zielländer, in denen sie wirken sollen. In Kiew sahen wir Demonstrationen für Europa, im Osten des Landes suchen die Menschen Schutz bei Russland. Insofern liegen die Dinge auch in der Ukraine nicht ganz so einfach, wie wir es im Westen gerne hätten.
Schulz: Ich bin nicht Ihrer Meinung. Das Problem in der EU ist, dass wir unser Wertesystem mal als Junktim anbieten und mal nicht. Wir leisten uns Doppelstandards. Unter dem Druck des EU-Freihandelsabkommens hat in Kolumbien der Generalstaatsanwalt 24 korrupte Abgeordnete hinter Gitter gebracht. Aber bei anderen Ländern wie China nehmen wir es dann mit unseren eigenen Werten nicht so genau und stellen die wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund. Das darf nicht sein.
Die EU leistet sich einen diplomatischen Dienst. Warum funktioniert er nicht?
Sandschneider: Weil die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik der EU nicht funktioniert. Das Einzige, was Lady Ashton als EU-Außenbeauftragter gelungen ist, ist der Aufbau eines gewaltigen Apparats, der Außenpolitik simuliert. Vor Ort kann kein Diplomat eine Außenpolitik umsetzen, wenn sie in Brüssel nicht formuliert wird. Vielleicht braucht Europa auch keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sind als Handelsnation ein großer Spieler in der Welt. Militärisch sind wir dort kaum unterwegs - aber müssen wir das? Spannend ist, was in anderen Teilen der Welt passiert. China wartet nicht, bis Europa mit einer Stimme spricht, die schaffen Fakten. Schauen Sie sich Afrika an: Da spielt China ganz ohne europäische Werte eine große Rolle, Europa ist selbst als Rohstoffpartner völlig außen vor.
Wieso kann Europa keine Geopolitik?
Schulz: Gemeinsame Außenpolitik kann ein Staat machen, aber die EU ist keiner. Wir müssen die Außen- und Sicherheitspolitik der EU regionalisieren. Und zwar so, dass alle etwas davon haben. Im Schwarzmeer-Raum etwa brauchen Bulgarien und Rumänien ökonomische Hilfe. In deren Nachbarschaft liegen die Ukraine und Russland, aber auch die Türkei. Wenn wir geostrategisch denken, müssen wir regionale Kooperation etwa im Bereich der Energiepolitik für den Schwarzmeer-Raum so organisieren, dass alle Anrainer profitieren. Im nördlichen Afrika gibt es rohstoffreiche Staaten wie Libyen oder Tunesien, die eine moderne Infrastruktur brauchen - und die könnten die Südländer der EU bauen, wenn wir rund um das Mittelmeer eine Handelszone schaffen. Davon profitieren Italien, Spanien oder Frankreich.
Werfen Sie gerade die Nachbarschaftspolitik der EU um?
Schulz: Wir sollten die Nachbarschaftspolitik ausbauen und die Interessen unserer Mitgliedstaaten stärker berücksichtigen. Am Handel im Mittelmeerraum hat Griechenland naturgemäß ein größeres Interesse als Finnland. Dies müssen wir anbinden an unsere internationale Handelspolitik. Denn dort geht es am Ende darum, ob wir ökonomischen Herausforderungen in anderen Regionen der Welt gewachsen sind oder nicht. Wenn Länder einen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie die Werte Europas nicht teilen und unsere teuren Sozial- oder Umweltstandards schlichtweg ignorieren, dann geraten wir auf Dauer mit unserem Demokratiemodell unter Druck.
Würden einzelne Länder in den Regionen jeweils die Führungsrolle übernehmen?
Schulz: Entweder müsste die EU koordinieren - oder einzelne Staaten tun dies im Auftrag der EU. Im Ostseerat zum Beispiel stellt sich die praktische Frage, wie die Anrainer allesamt Zugang zum europäischen Markt bekommen können, ohne dass alle Beteiligten die Gesetze der EU sofort übernehmen. Wenn wir das lösen, könnte auch Russland von der regionalen Kooperation profitieren und müsste seine geostrategische Rolle nicht ständig ausspielen.
Sandschneider: Wenn ich Sie recht verstehe, sind Sie nicht für ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sondern für ein Europa der unterschiedlichen Kompetenzen. Das leuchtet mir ein. Wenn ich Ihre Aussagen zu Europa richtig lese, dann halten Sie die gleichmachenden Tendenzen in der EU, von Nordfinnland bis Südsizilien alles einheitlich zu gestalten, für das größte Gift in der Union. Für wie realistisch halten Sie denn diese Vorstellung einer regionalisierten Außenpolitik?
Schulz: Mir schwebt ein Europa der unterschiedlichen Fähigkeiten vor. Wenn wir uns Einheit in Vielfalt vornehmen, dann muss es zu einem Gleichgewicht zwischen Einheit und Vielfalt kommen. Die Vielfalt beinhaltet die Stärke Europas, zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Mit dem Ziel, dass dieser europäische Rahmen ein Mehr an Frieden, Sicherheit und Wohlstand für alle bringt. Das kriegt man nicht durch Zentralisieren hin.
Sandschneider: Der Westen hat in den vergangenen 20 Jahren gelernt, dass wir einen Diktator aus dem Amt bomben können, aber uns fehlen die Fähigkeiten, Länder ökonomisch zu stabilisieren. Und stets haben wir schnell die Grenze der Belastbarkeit erreicht - unser Freund Wladimir Putin weiß das genau. Wir können ihm den G8-Gipfel wegnehmen, und wir können über Sanktionen reden, aber mehr können wir nicht. Das lädt andere Akteure ein, traditionelle Machtpolitik zu machen. Wir selber haben sie allerdings verlernt.
Ist die Bundesregierung in der Lage, einen neuen Anlauf in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik durchzusetzen?
Schulz: Mit Frank-Walter Steinmeier ist eine Reeuropäisierung der deutschen Außenpolitik bereits im Gange. Ich habe keinen Zweifel, dass die gesamte Bundesregierung eine stärkere Rolle Deutschlands bei dieser Europäisierung will. Steinmeier hat sehr schnell öffentlich gemacht, dass deutsche und europäische Interessen zwei Seiten einer Medaille sind. Ein starkes Europa ist gut für die Bundesrepublik, eine starke Bundesrepublik ist gut für Europa.
Deutschland hat 2008 die Mittelmeerunion blockiert, einen Versuch Frankreichs zur Regionalisierung der europäischen Außenpolitik. Warum sollte Berlin das Konzept diesmal unterstützen?
Schulz: Über mein Modell muss man erst einmal diskutieren, es hat noch keinen regierungsamtlichen Charakter. Vielleicht muss man es auch weiter denken. Aber in diesem Land, auf diesem Kontinent wagt ja niemand zu denken...
Sandschneider: Na?
Schulz: Doch vielleicht zu denken, aber nicht laut zu reden...
Sandschneider: Bezogen auf die politische Kaste haben Sie recht...
Schulz: Wir müssen Europa vom Kopf auf die Füße stellen. Die faszinierende Idee der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann da eine zentrale Rolle spielen. Denn das ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit. Wenn sich in den Köpfen der Menschen der Eindruck festsetzt, dass es einen Brüsseler Zentralismus gibt, der uns fremdbestimmt, dann muss man alle Mittel ergreifen, um dieses Bild zu korrigieren.
Sind die Vorzüge Europas für die Europäer zur Selbstverständlichkeit verkommen?
Sandschneider: Wir sind beide ungefähr gleich alt, beide aufgewachsen in Grenzgebieten. Sie an der Grenze zu Holland, ich an der zu Frankreich. Für unsere Generation ist die Idee Europas, die Sie beschreiben, noch greifbar. Wir haben Schlagbäume gesehen, wir haben Grenzkontrollen beim Baguette-Kaufen erlebt, wir haben Geld umgetauscht. Das ist alles weg. Ist für die Generation unserer Kinder die Idee von Europa noch zündend?
Schulz: Eindeutig nein. Nehmen wir die Friedensdividende, die unser Leben noch geprägt hat. Für die junge Generation spielt dies keine Rolle mehr. Sie sehen die Werte als für immer gesichert an, als wenn sie wie Strom aus der Steckdose kämen. Es redet ja niemand mit den jungen Leuten über diese Werte. Wir reduzieren die EU immer auf eine Nutzwerte-Union, statt auf eine Werte-Union.
Müsste die Wirtschaft sich in diese Debatte stärker einmischen und den Wert der EU herausstellen?
Sandschneider: In der öffentlichen Debatte ist die Einmischung der Wirtschaft nur ungern gesehen. Ich staune Bauklötze, wie sich große, global tätige Unternehmen den Luxus leisten, die Zielregionen ihrer Investitionen nicht zu kennen. Sie wundern sich manchmal, wenn sie dort scheitern und dabei richtig viel Geld verlieren.
Bundespräsident Joachim Gauck und Außenminister Steinmeier verlangen, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernimmt. Sollte auch die Wirtschaft ihre Interessen stärker betonen?
Sandschneider: Was für eine seltsame Diskussion! Es geht hier gar nicht darum, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und Deutschland hatte auch nie eine Kultur der Zurückhaltung in der Außenpolitik. Wir haben uns immer eingemischt und waren damit oft sehr erfolgreich. Man denke nur an das Engagement deutscher politischer Stiftungen in Südeuropa, in Mittel- und Osteuropa, mittlerweile auch im arabischen Raum und sogar Lateinamerika. Beispiele dieser Art gibt es zur Genüge. Aber wir müssen Verantwortung übernehmen, wo es unsere eigenen Interessen betrifft, die deutschen wie die europäischen. Europa ist im globalen Konzert viel besser unterwegs, als wir glauben.
Ist die Krise Europas überwunden?
Sandschneider: Jeder Text, den ich heute zu Europa lese, konstatiert die Krise der Europäischen Union. Jetzt befinden wir uns also seit fünf Jahren in einer Krise. Irgendwann ist die Krise Normalzustand. Dann kann man es auch lassen. An mancher Stelle, auch was die Außenwirkung angeht, reden wir uns stärker in die Krise, als wir es tatsächlich sind.
Schulz: Wenn Menschen sich von einem Projekt abwenden, dann ist das Projekt verloren. Das ist für alle Diktatoren eine schlechte Nachricht, denn früher oder später wenden sich die Menschen auch von der Diktatur ab. Aber es ist auch ein Alarmsignal für Demokratien, wenn die Menschen das Gefühl haben, die Demokratie dient nicht mehr ihren Interessen. Dann wenden sie sich auch von der Demokratie ab. Das erleben wir auch in einigen Ländern in Europa. Darum muss ich sagen: Europa steckt in einer tiefen Krise, die auch eine Vertrauenskrise ist. Sie hat auch dazu geführt, dass wir kein Geld in die Ukraine geben können. Sie absorbiert unsere Kraft so stark, dass wir nach außen nur bedingt handlungsfähig sind.
Wie wird dies im schlimmsten Fall enden?
Schulz: Ich warne davor zu glauben, die Krise sei zu Ende, nur weil wir ein paar bessere Wirtschaftsdaten haben. Wir brauchen eine Bankenunion, die diesen Namen verdient. Wir brauchen die Regulierung der Finanzmärkte, um das Vertrauen der Menschen wieder zurückzubekommen.
Sandschneider: Wir haben das Problem, dass wir in den vergangenen Jahren auf der Ebene der Partizipation gut unterwegs waren, die Effizienz dabei aber auf der Strecke geblieben ist. Und die Menschen wollen effiziente Lösungen. Wenn heute manch ein Autokrat etwa in China noch im Amt ist, dann auch, weil die Menschen dort das Gefühl haben, dass der Staat Probleme effizient löst. Wenn Menschen genau dieses Gefühl nicht mehr haben, wenden sie sich ab - von Autokratien wie von Demokratien. In der Ostukraine wollen manche zurück zur Sowjetunion, weil es damals den Menschen besser ging. So simpel ist das manchmal. Ich erinnere mich an den Satz einer jüngeren Ägypterin, die mir sagte: Mir ist es egal, wer mich regiert, Diktator, Militär oder Präsident. Hauptsache, der schafft Jobs. Das fand ich einen bemerkenswerten Satz.
Müssen wir die Wirtschaft in der Debatte über Europa wieder stärker in den Mittelpunkt rücken? Weg von der Moral, wie Sie das immer fordern?
Sandschneider: Für mich gilt ein Satz: Moral ist immer analysefern. Wenn Sie nicht wissen, worüber Sie reden, dann verfallen Sie in moralinsaure Aussagen. Das ist kein deutsches oder europäisches Problem, aber es ist ausgesprochen gefährlich. Die Menschen sind nicht doof. In jedem Land der Welt sehen sie, ob es ihnen gut oder weniger gut geht. Dieser Hang, Erfahrung und Kompetenz durch Moral zu ersetzen, ist etwas, was uns ganz gewaltig im Weg steht. Wie immer diese Krise ausgeht, ganz am Ende wartet ein Schock, mit dem wir überhaupt nicht rechnen. Es wird der Schock sein, wenn wir morgens wach werden und andere Teile der Welt sich einen Dreck drum scheren, was wir Europäer denken, weil sie sich machtpolitisch ganz anders aufgestellt haben. Dazu gehören unsere chinesischen Freunde, dazu gehören aber auch Indien und Brasilien, wo solche Debatten ohne jeden Bezug zur europäischen Befindlichkeit geführt werden. Wir tun immer so, als seien wir noch der Nabel der Welt. Aber in Indien sehen diese Debatten ganz anders aus.
Sehen Sie das auch so?
Schulz: Europa stellt heute 7,8 Prozent der Erdbevölkerung mit 30 Prozent Anteil am Weltbruttosozialprodukt. 2040 werden wir bei etwa vier Prozent Bevölkerungsanteil stehen und zehn Prozent zur globalen Wirtschaftsleistung beitragen. Europa wird entweder diese zehn Prozent geeint vertreten, oder die einzelnen Länder der europäischen Union sind Spielball der Machtinteressen anderer Weltregionen. Wenn einzelne Staaten der EU nach China fahren und bilaterale strategische Abkommen abschließen, dann ist das ein Eigentor.
Sandschneider: Wer ist in Ihrem Konzept der unterschiedlichen Kompetenzen eigentlich für China zuständig? An eine gemeinsame europäische Außenpolitik glaube ich erst, wenn die Bundeskanzlerin in ein Flugzeug steigt und französische, britische und spanische Geschäftsleute dabeihat.
Schulz: Nein, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Sie muss die Interessen der Bundesrepublik Deutschland schützen. Es ist Aufgabe der europäischen Organe, die Interessen der EU zu schützen, das kann kein einzelnes Land stellvertretend für andere machen. Wenn der EU-Handelskommissar in Peking sagen kann, alle EU-Mitglieder stehen geschlossen hinter mir, dann werden uns die Chinesen ernst nehmen.
Sandschneider: Das dauert aber noch ein Weilchen.
/// DER MAHNER // .
Sandschneider, 58, ist seit 2003 Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der Politikwissenschaftler lehrte an der Universität in Mainz und hat einen Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin. Von 1999 bis 2001 war er Geschäftsführender Direktor des Otto-Suhr-Instituts.
/// DER PRAKTIKER // .
Schulz, 58, ist seit Januar 2012 Präsident des Europäischen Parlaments (EP) und derzeit Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas bei der Europawahl im Mai. Der SPD-Politiker gehört dem Europäischen Parlament seit 1994 an. Ab 2004 leitete er die sozialdemokratische Fraktion im EP.
„Wir haben Machtpolitik verlernt“ von Florian Willershausen und Silke Wettach, Wirtschaftwoche 11/2014 vom 10.03.2014 von
www.wiwo.de.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.